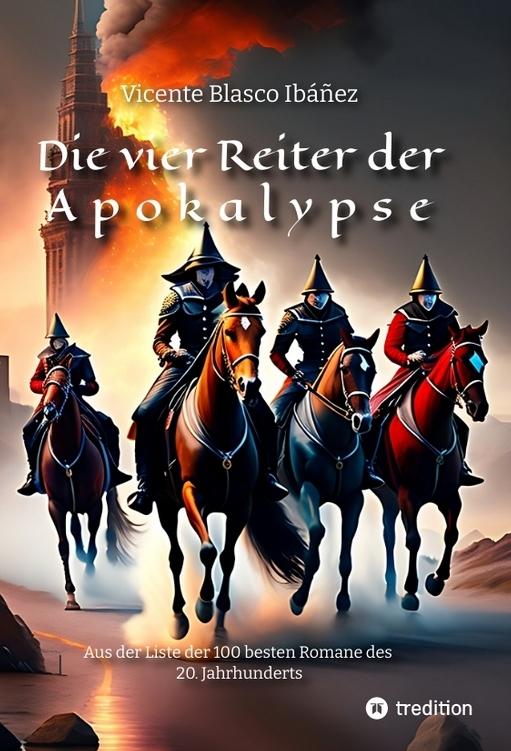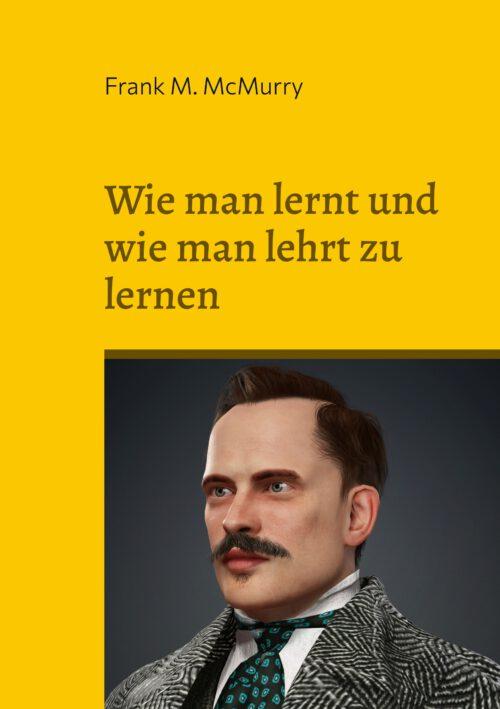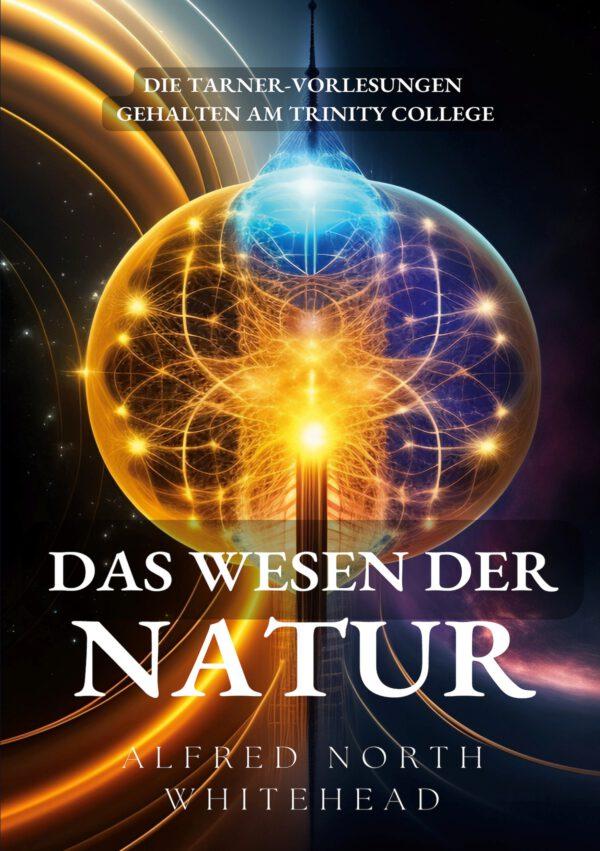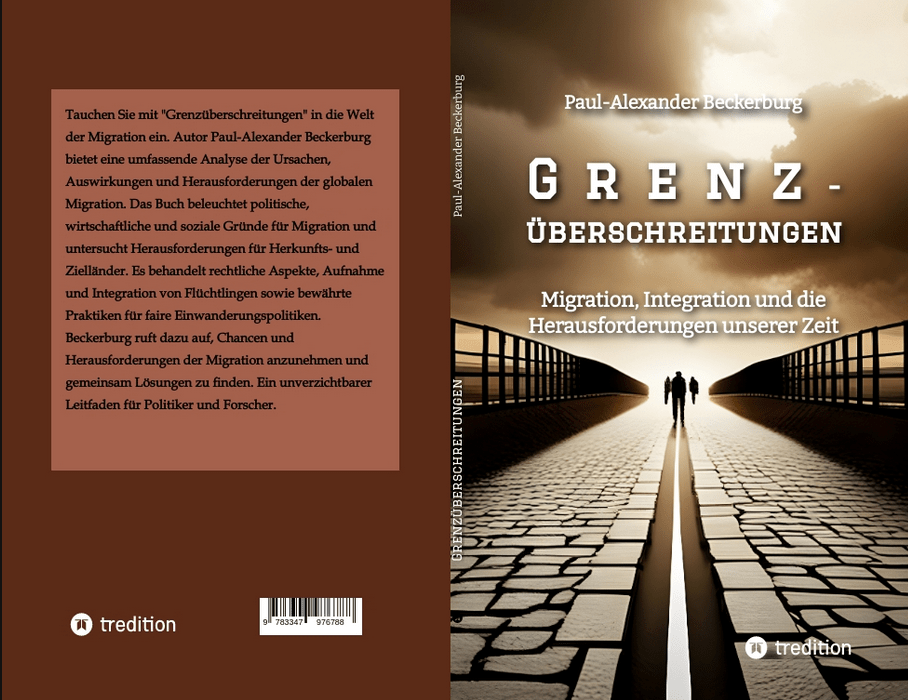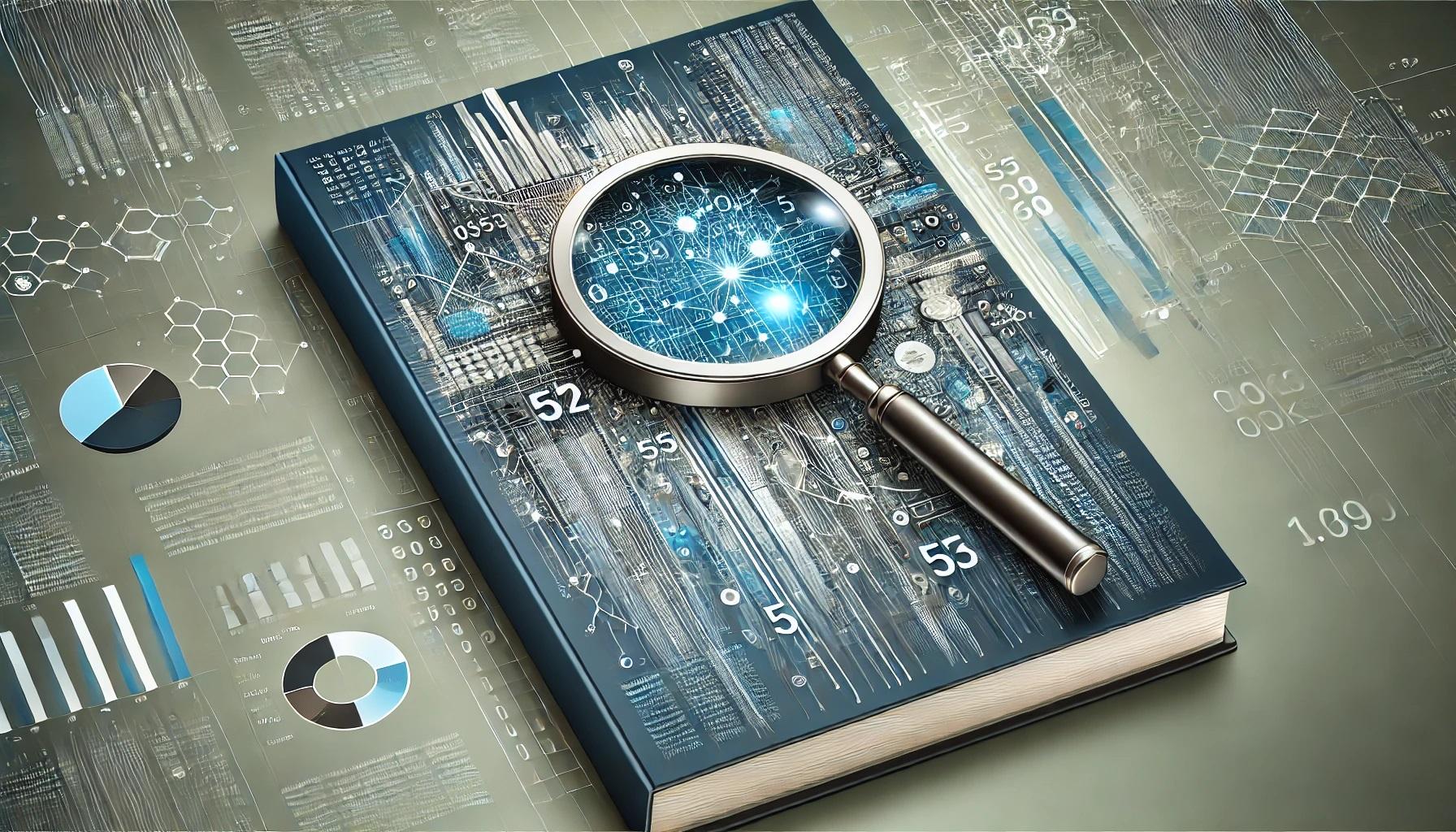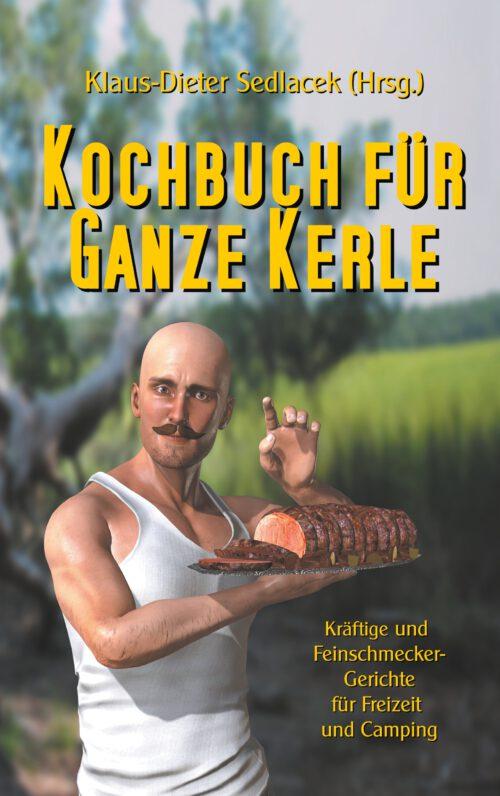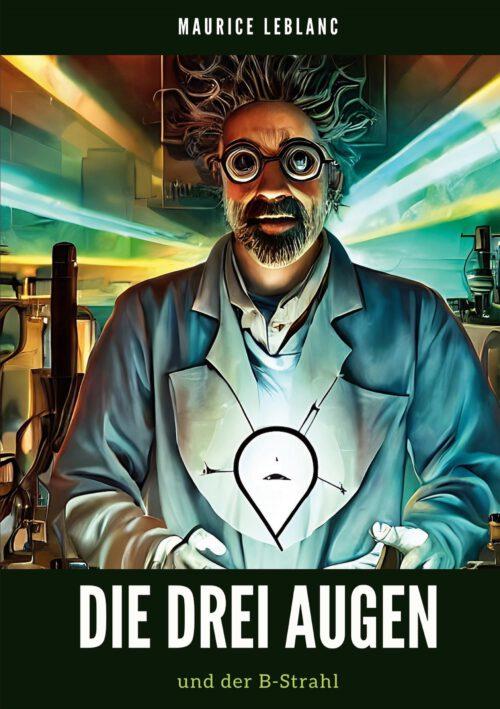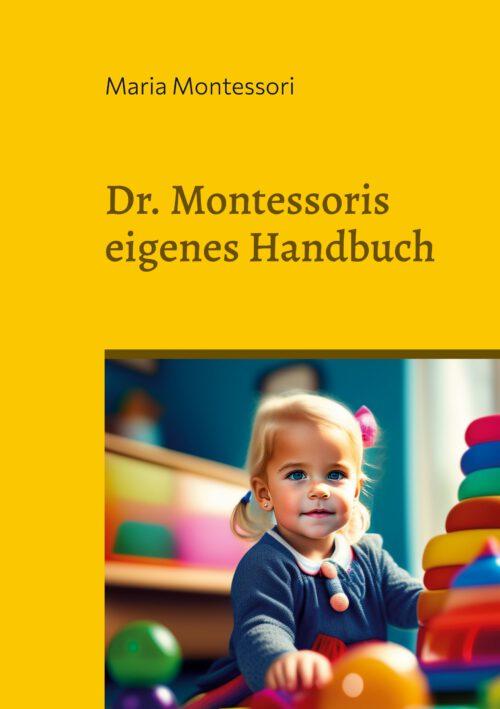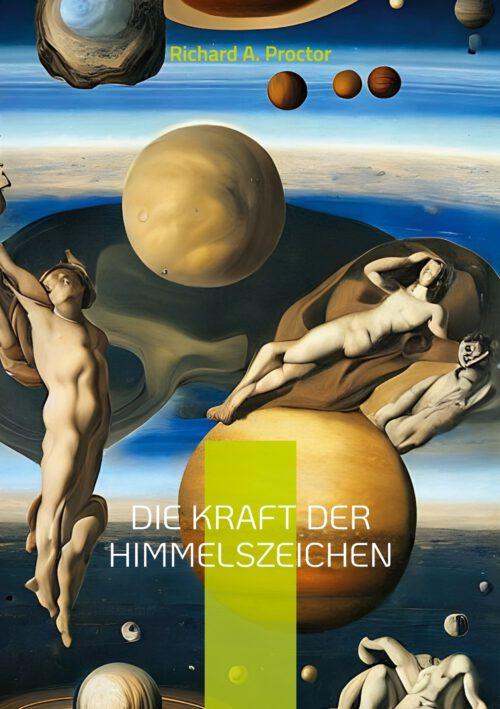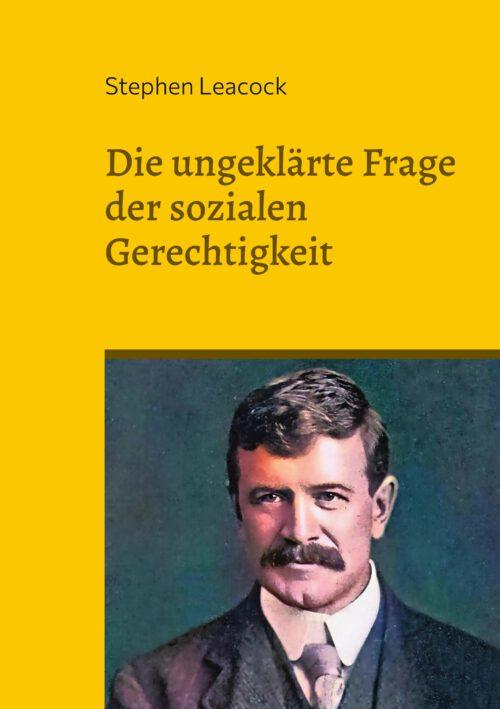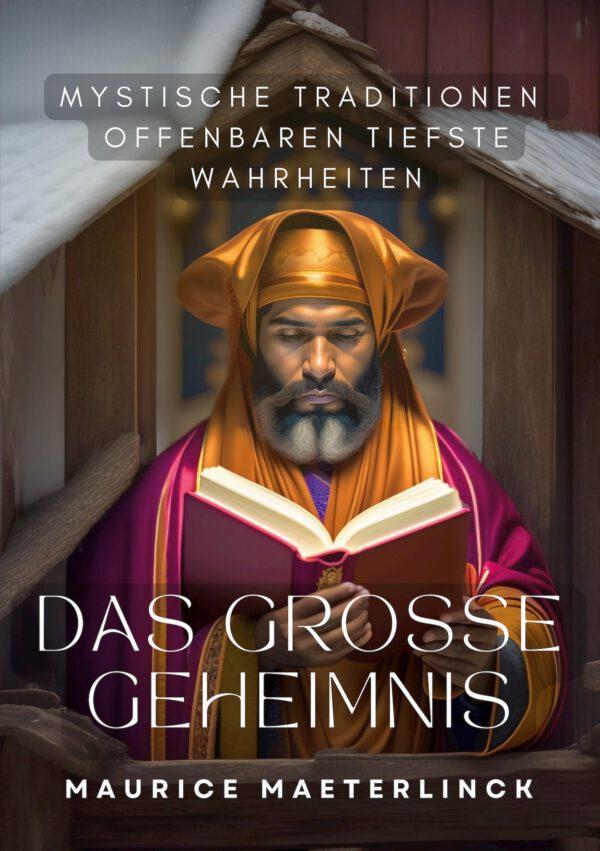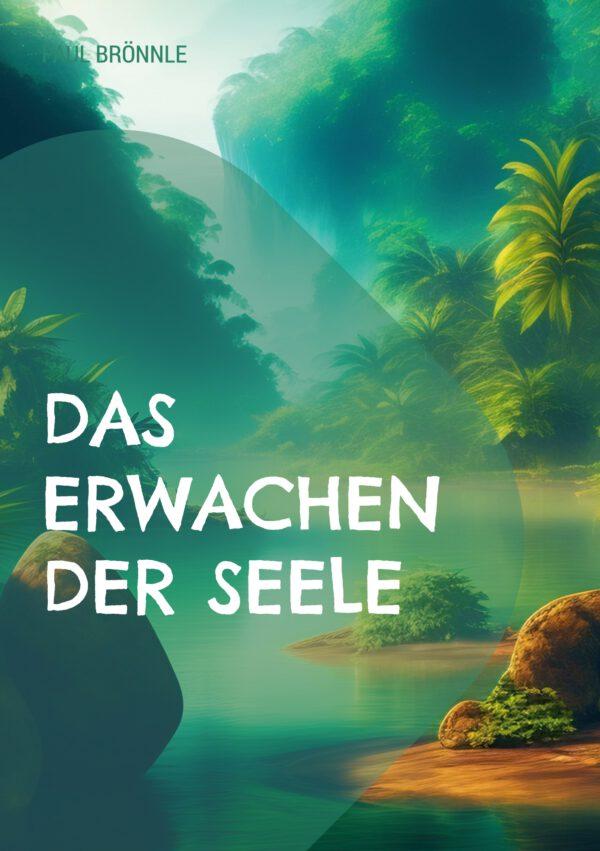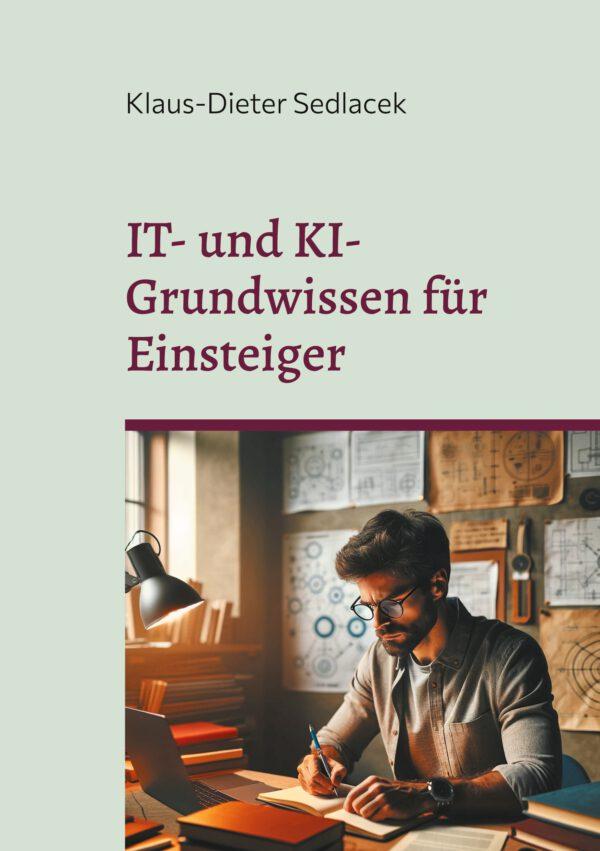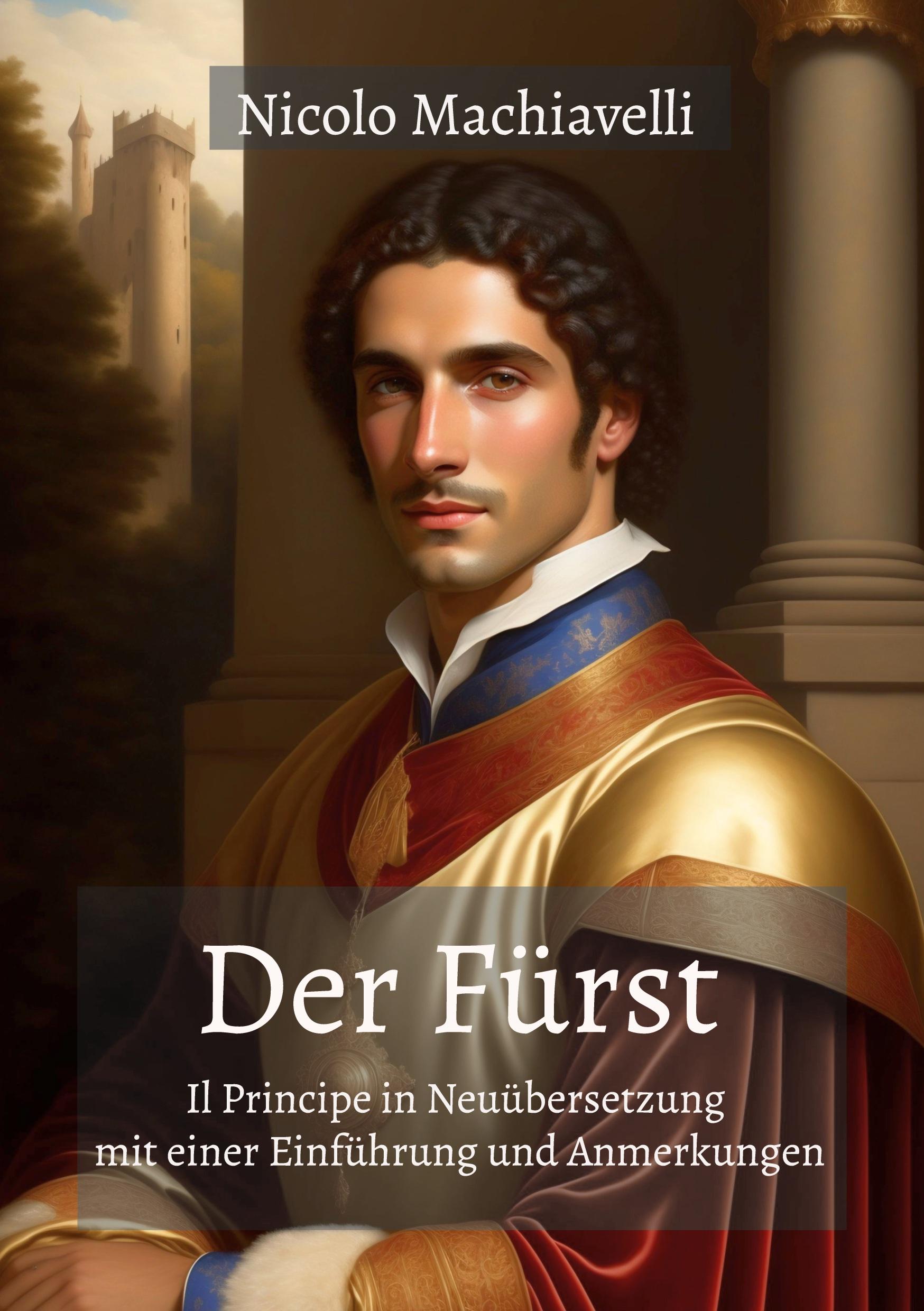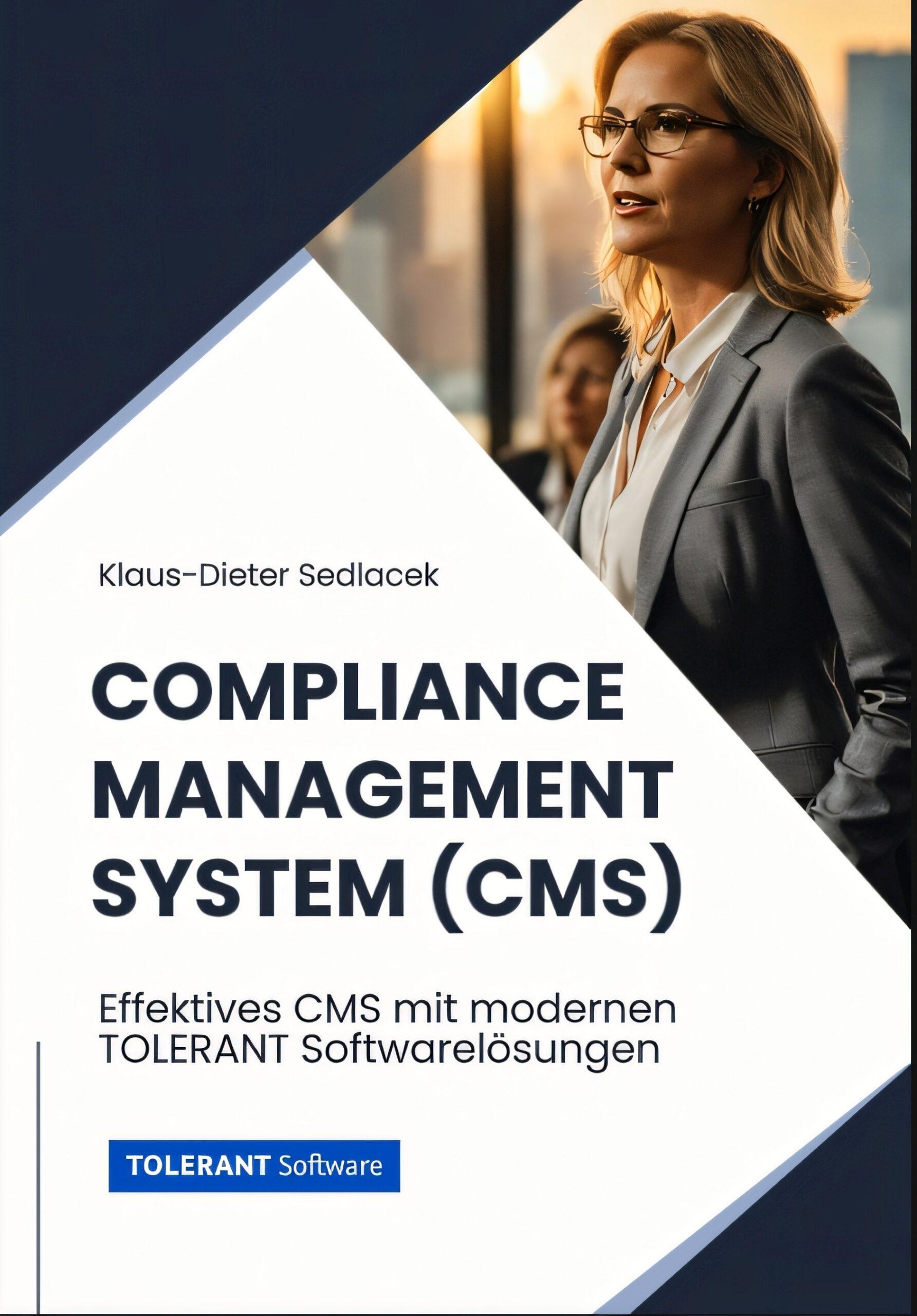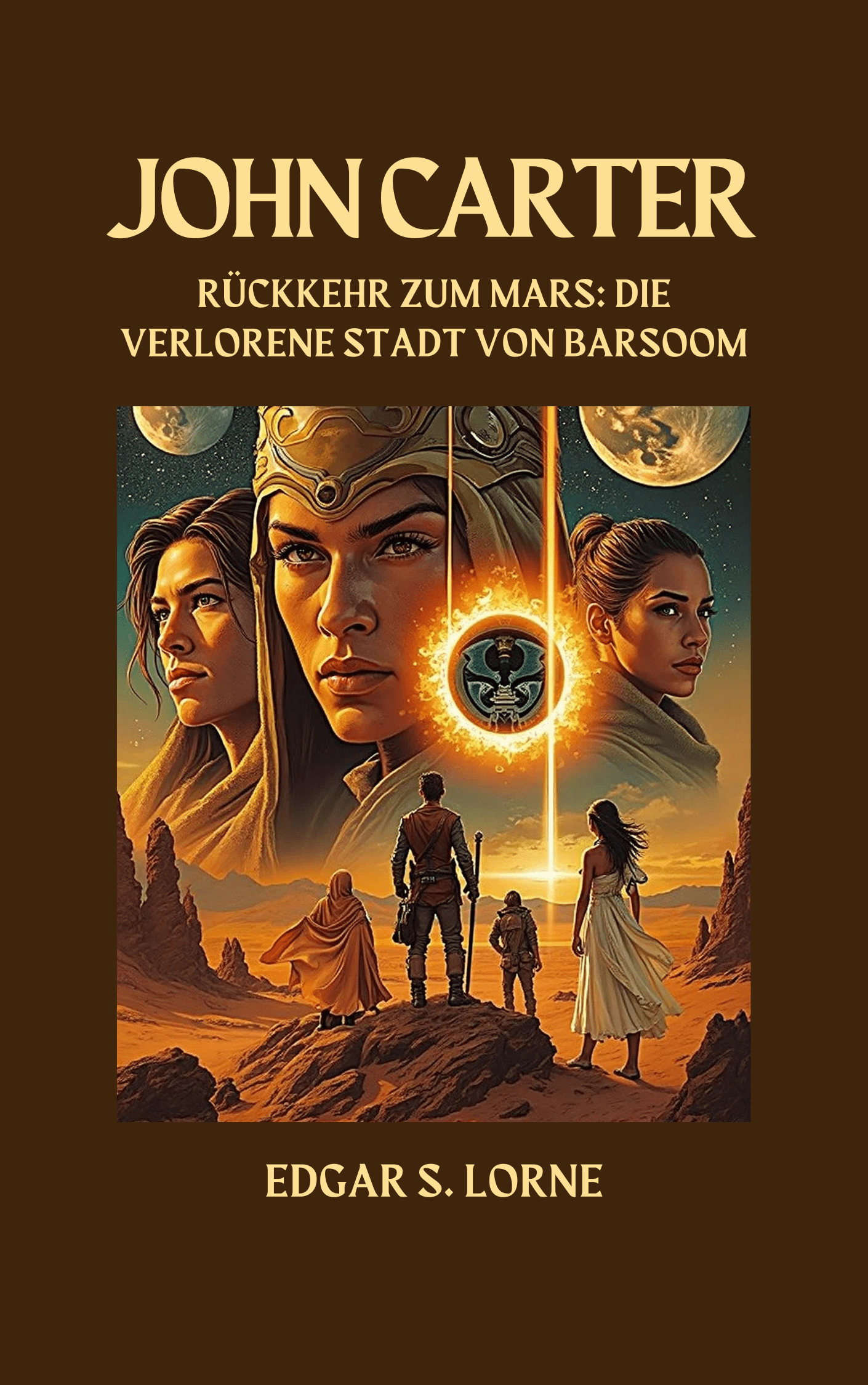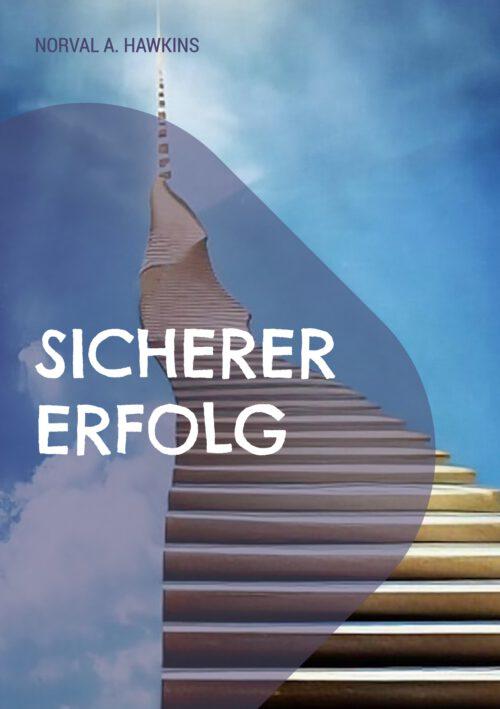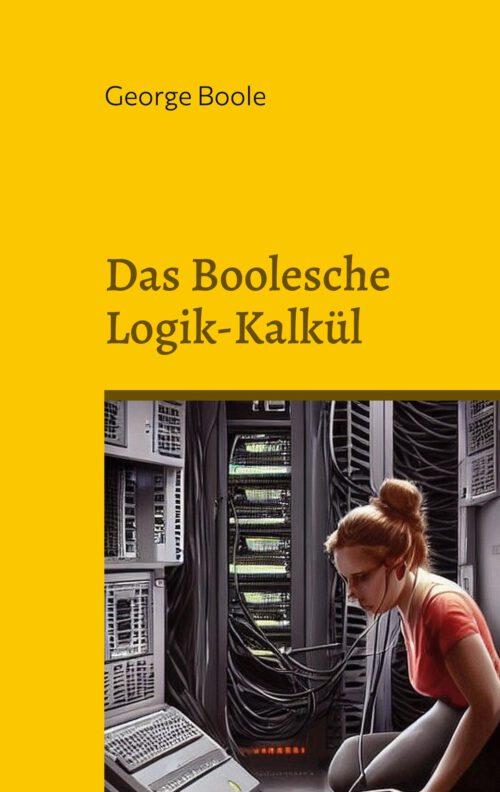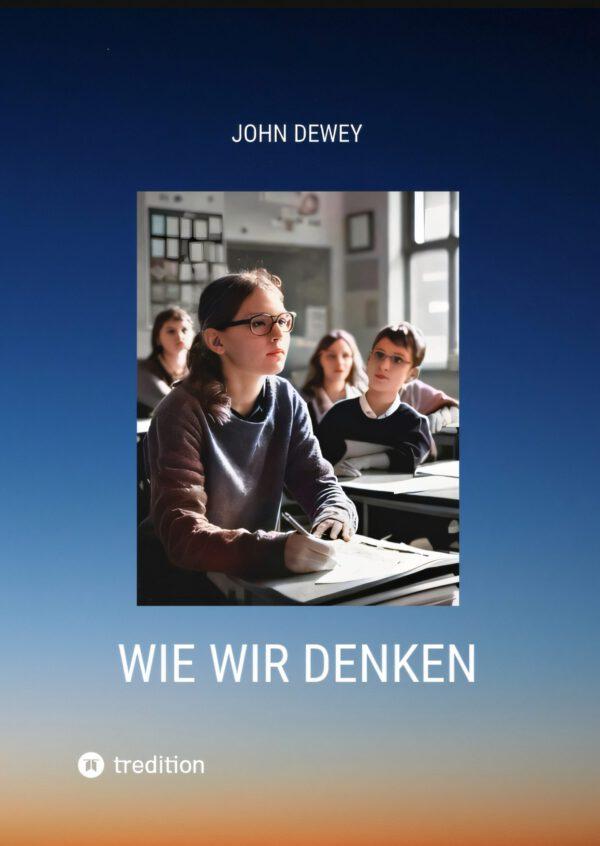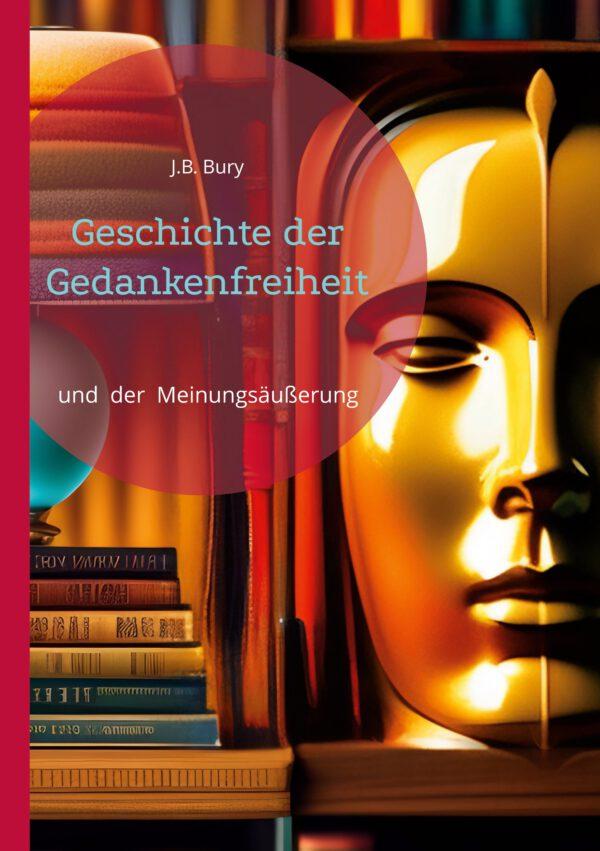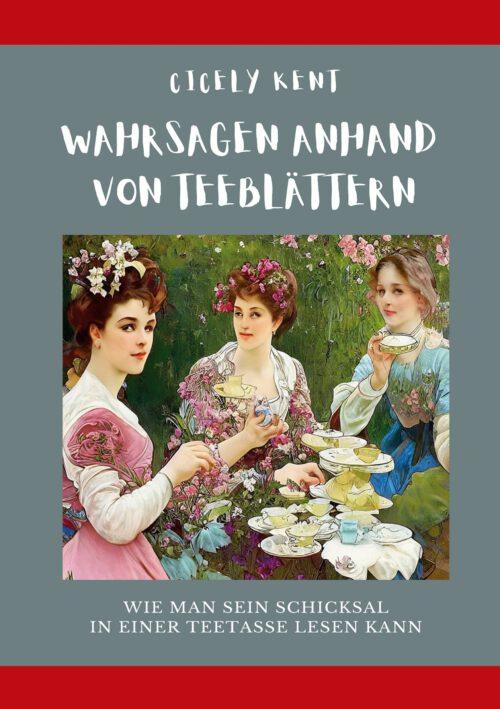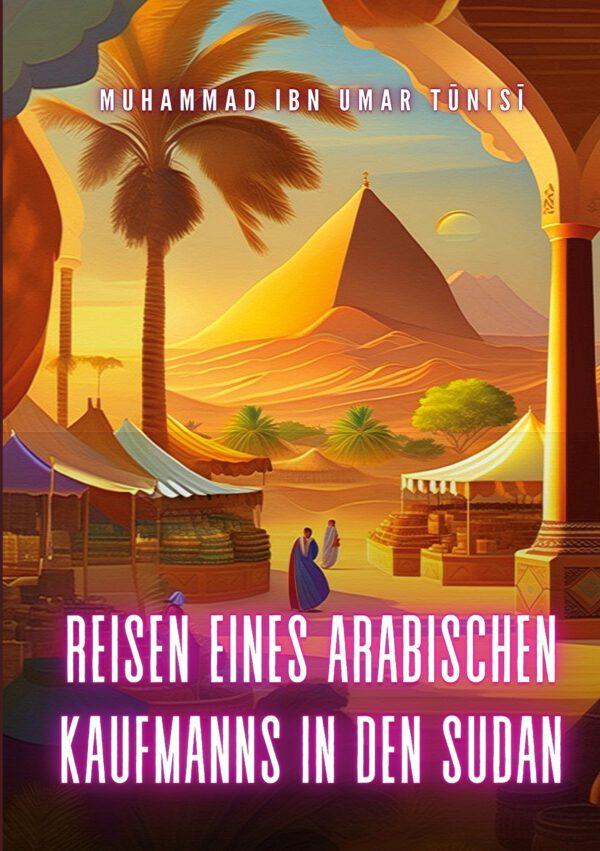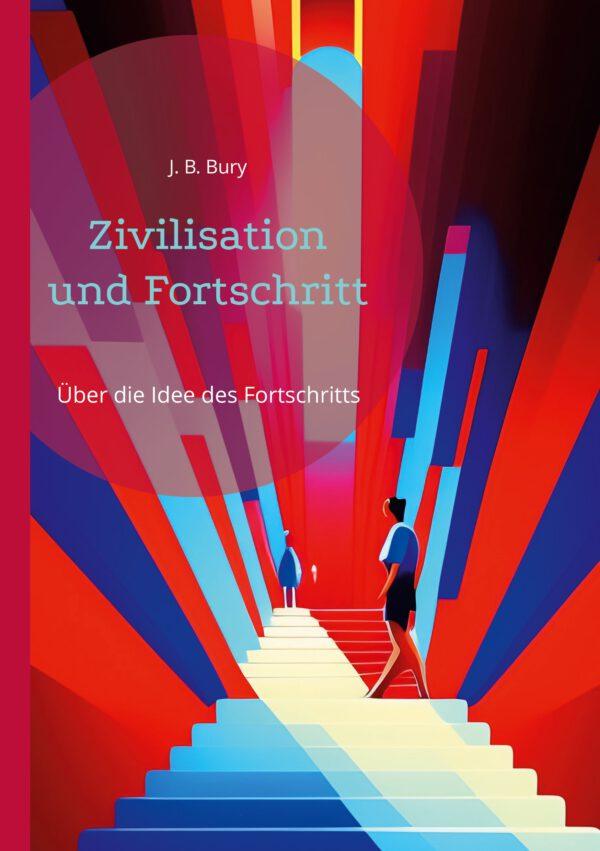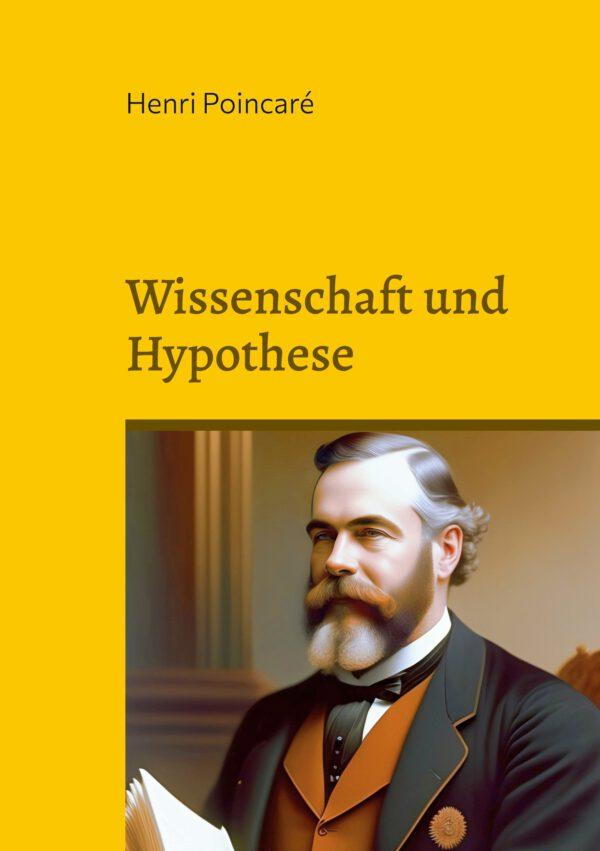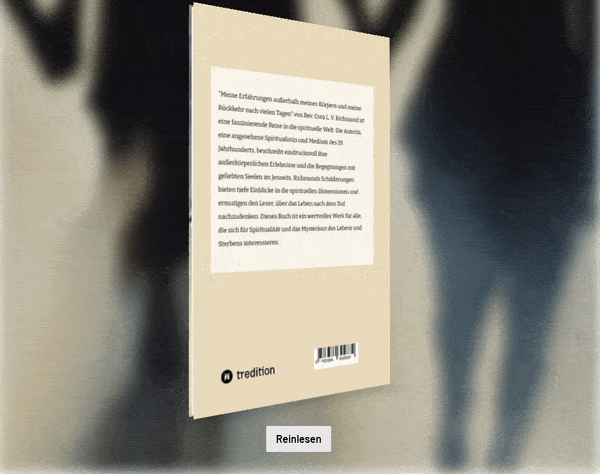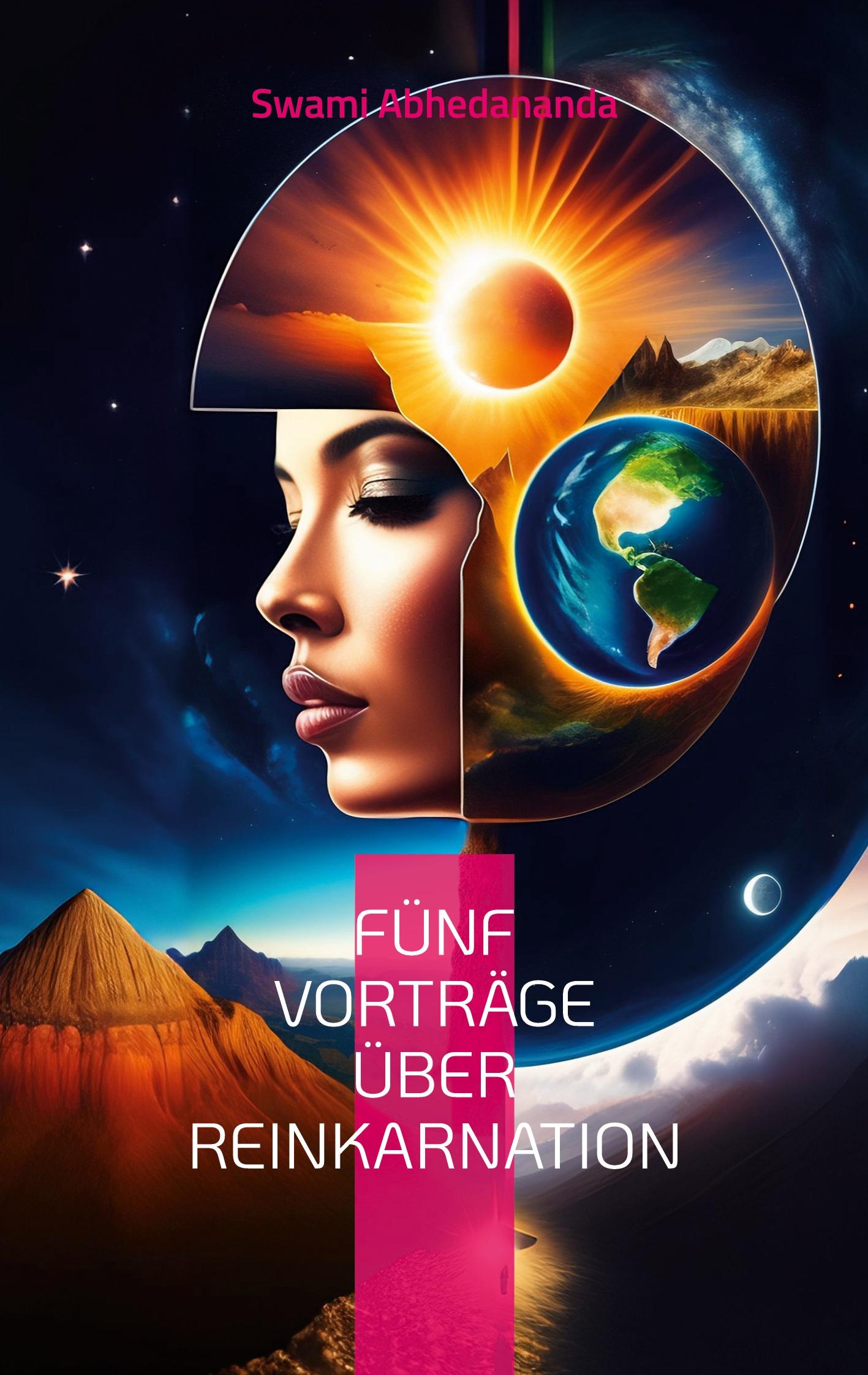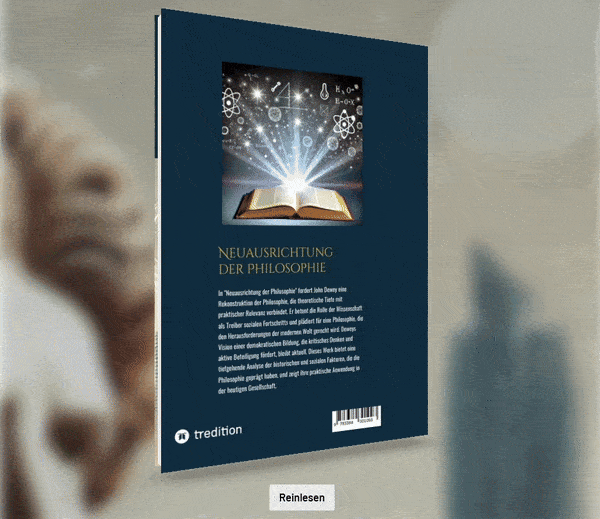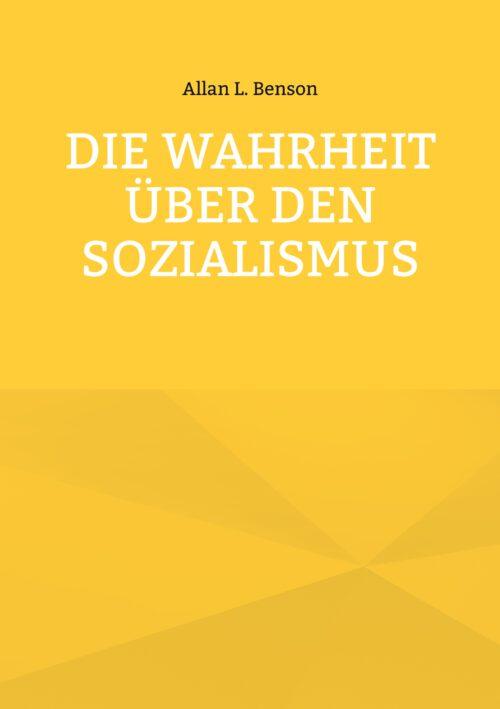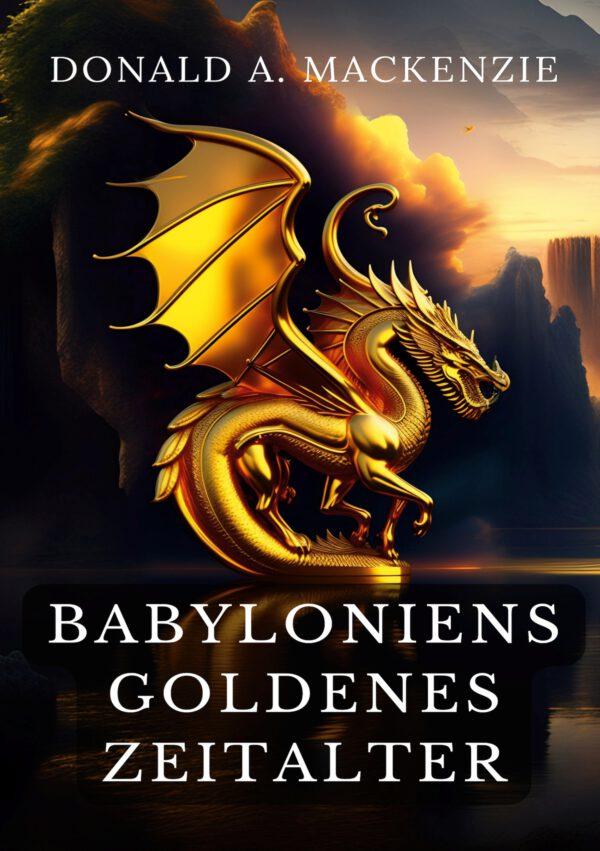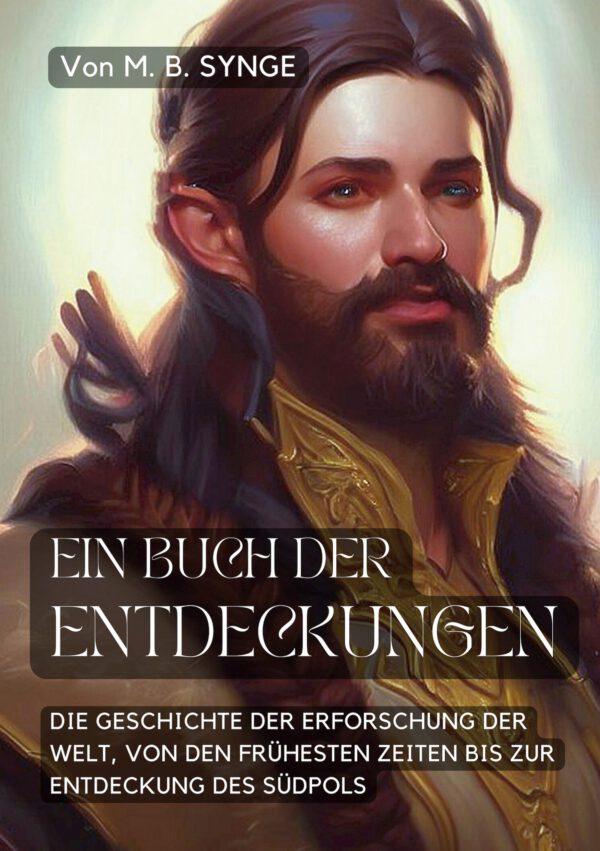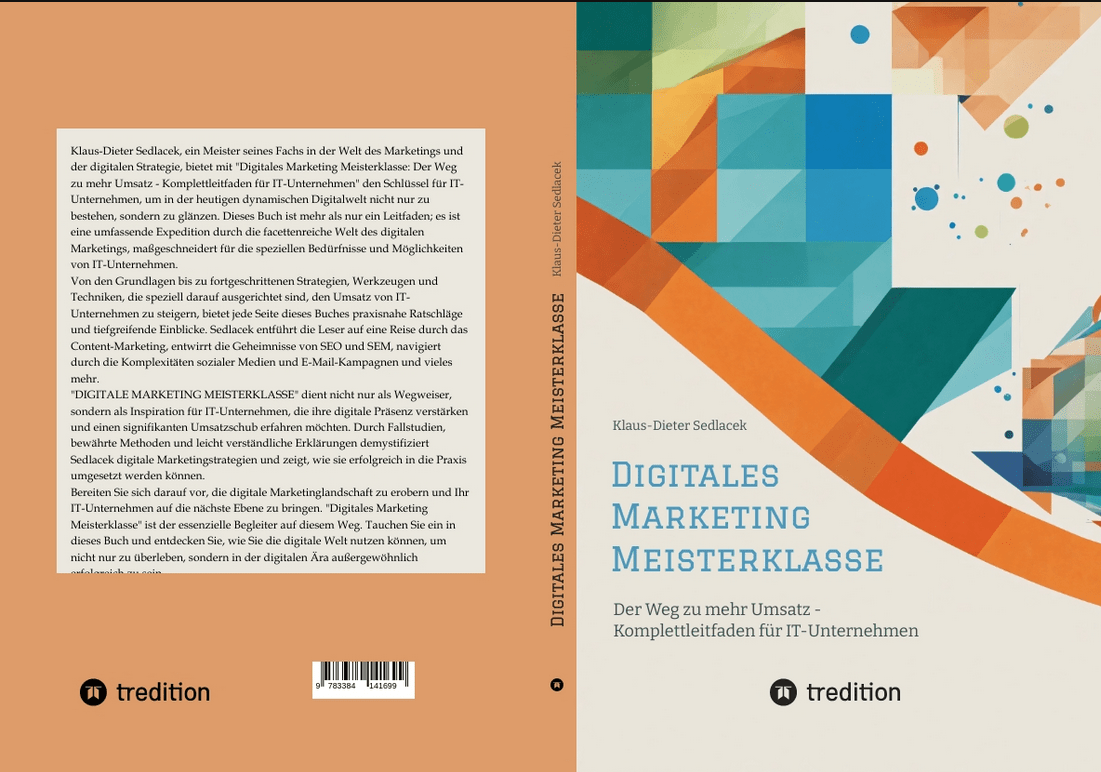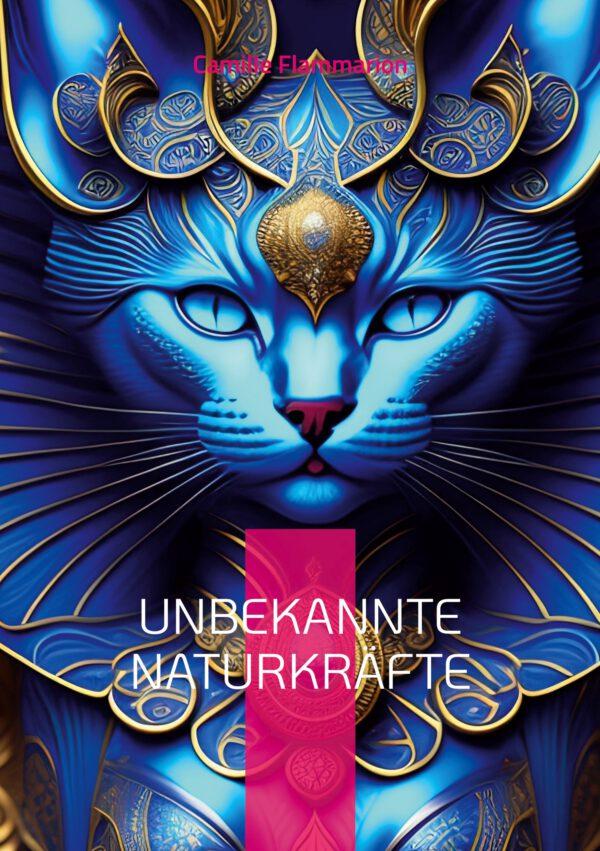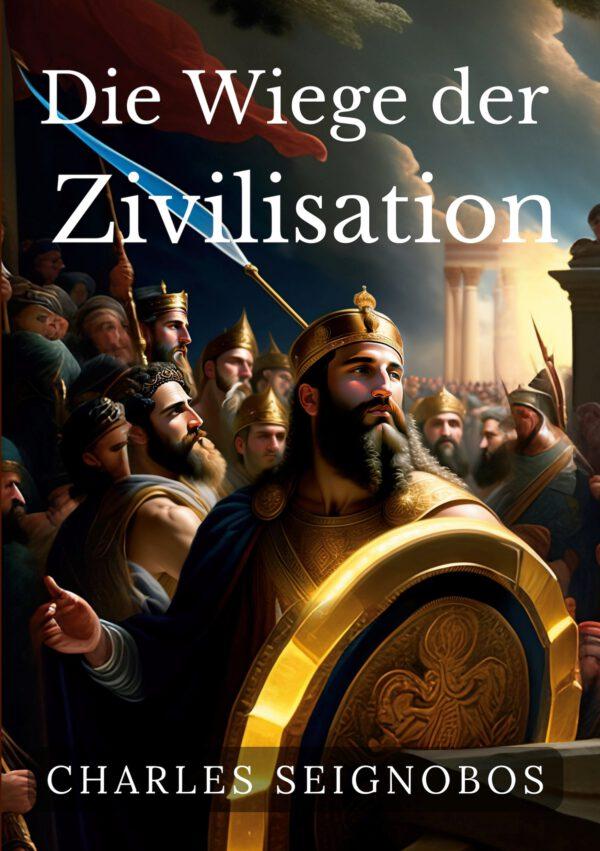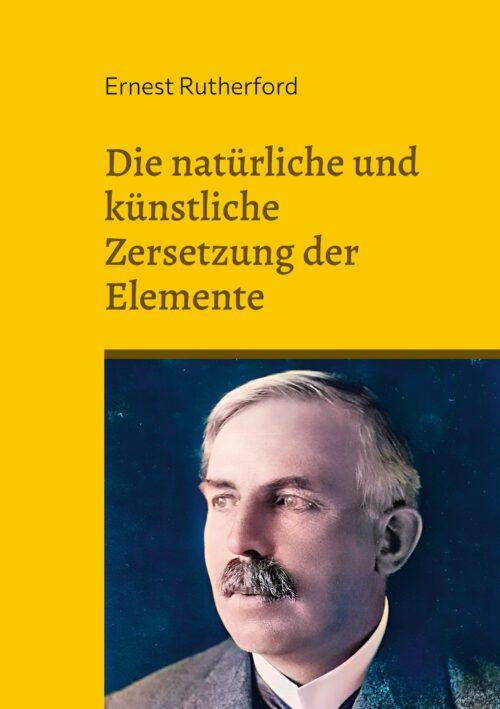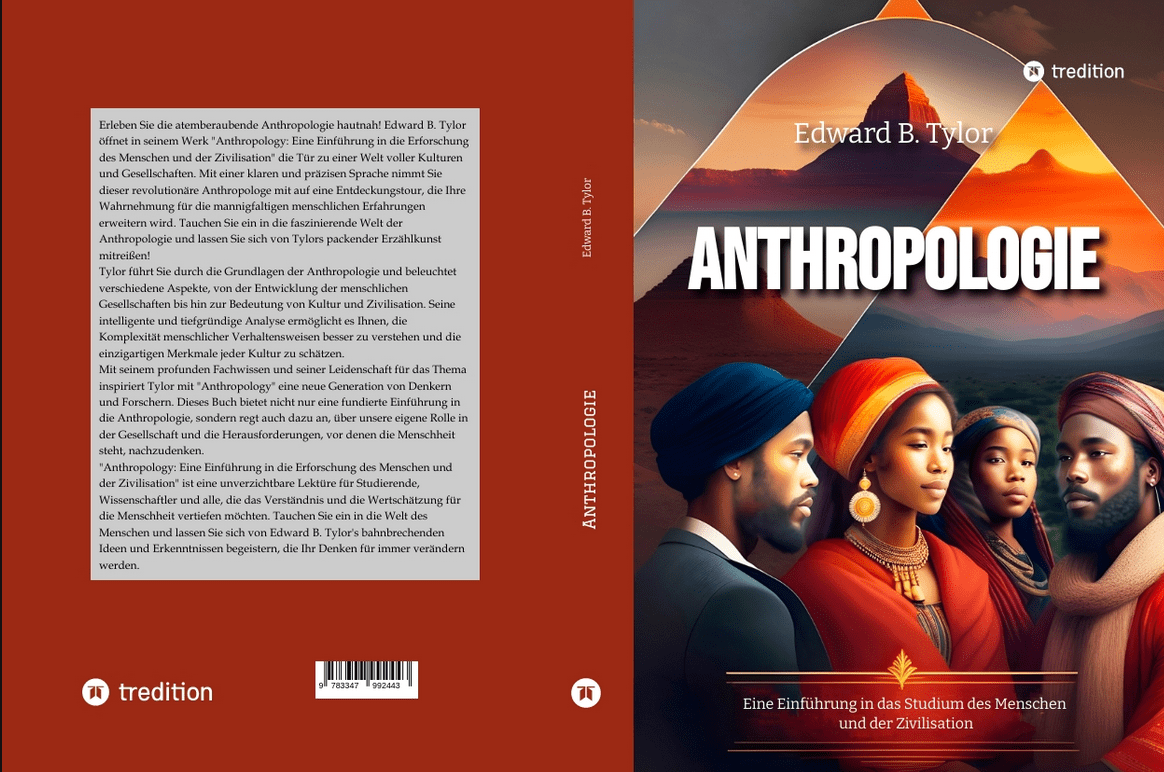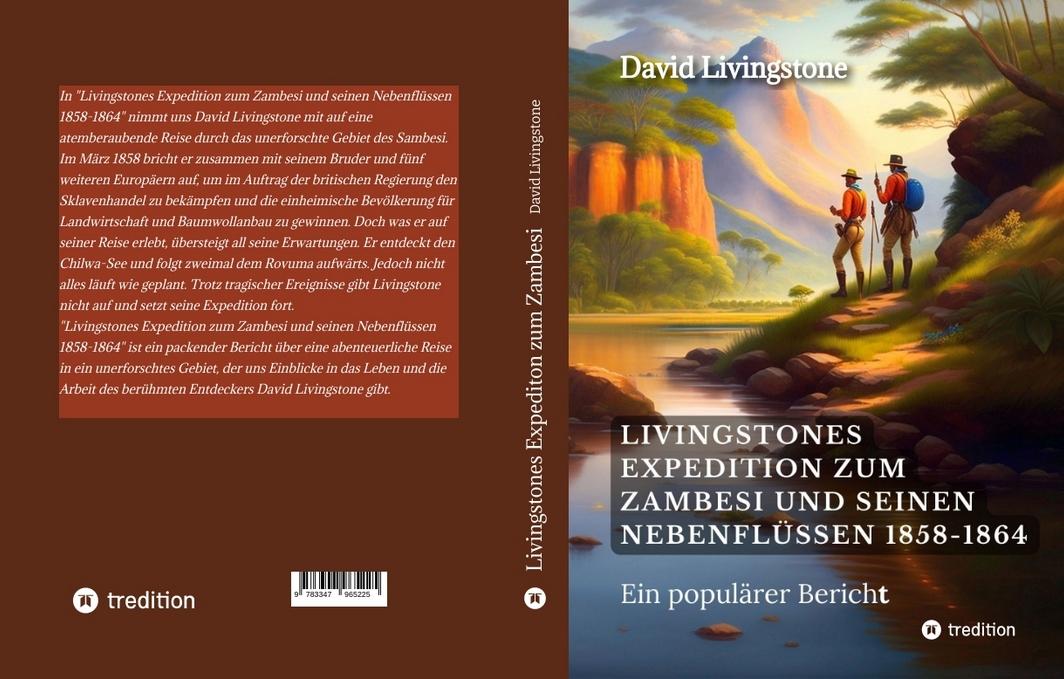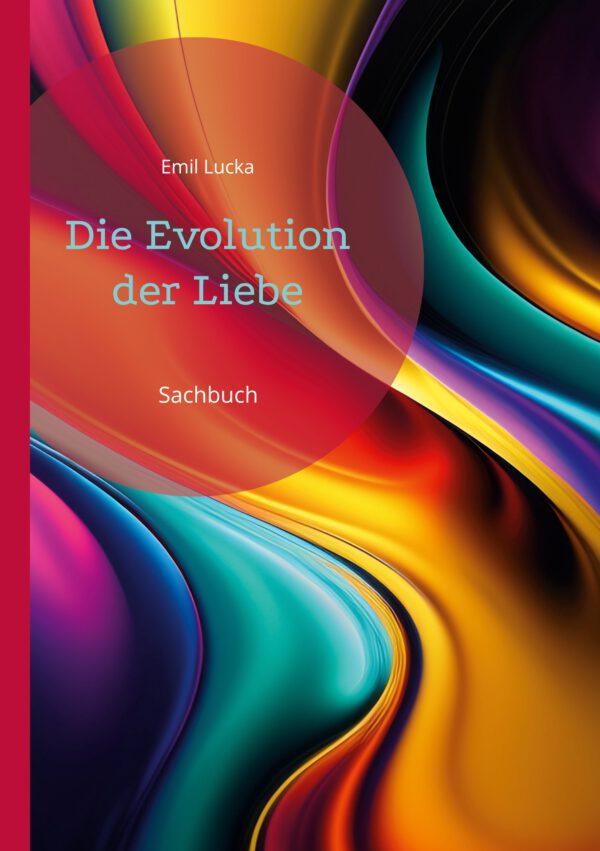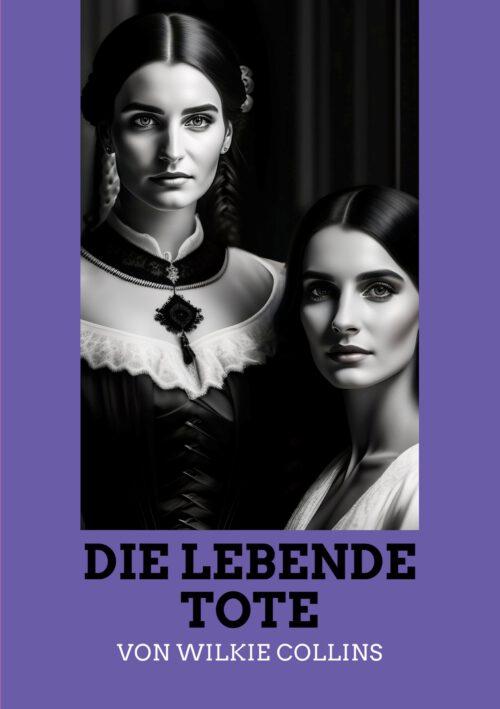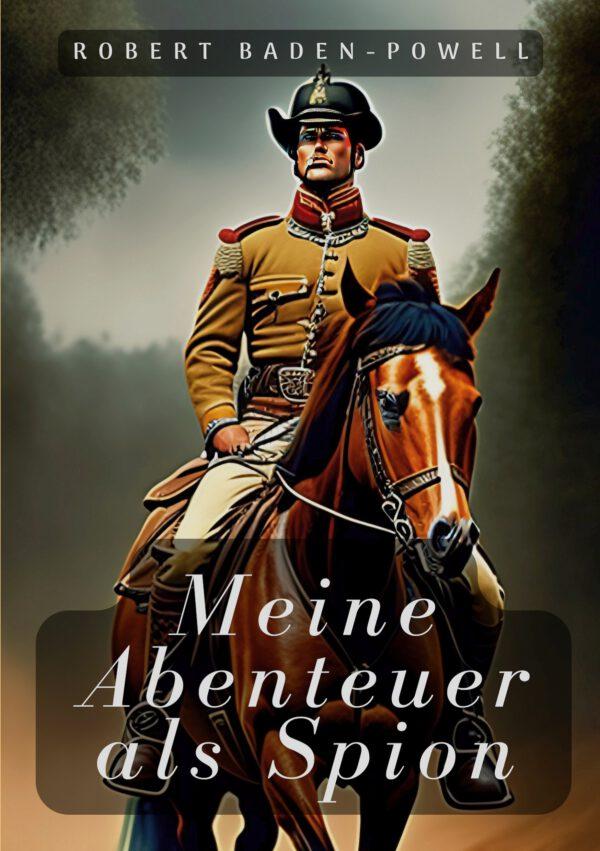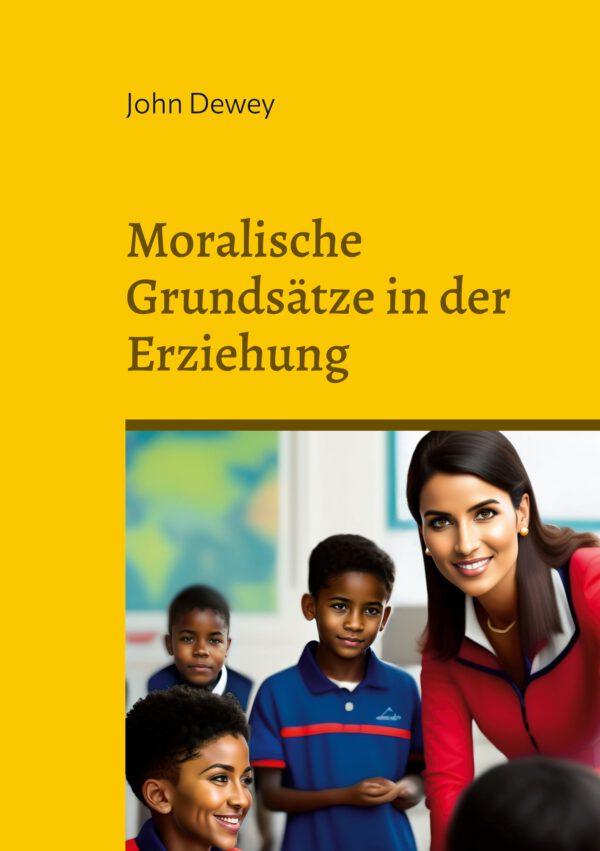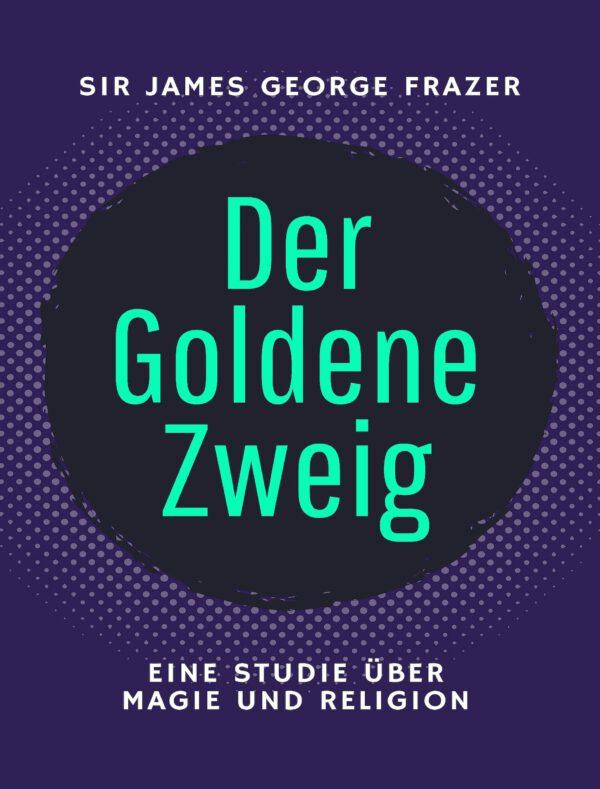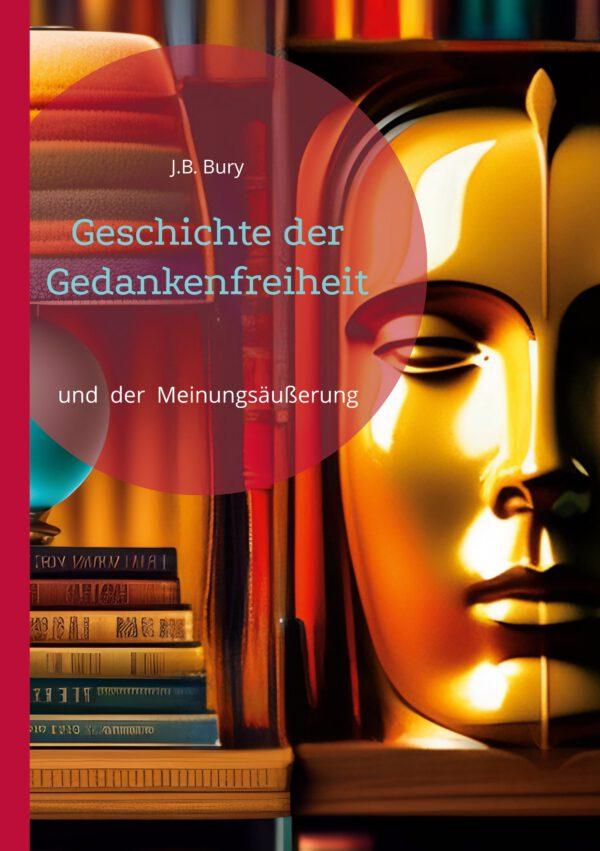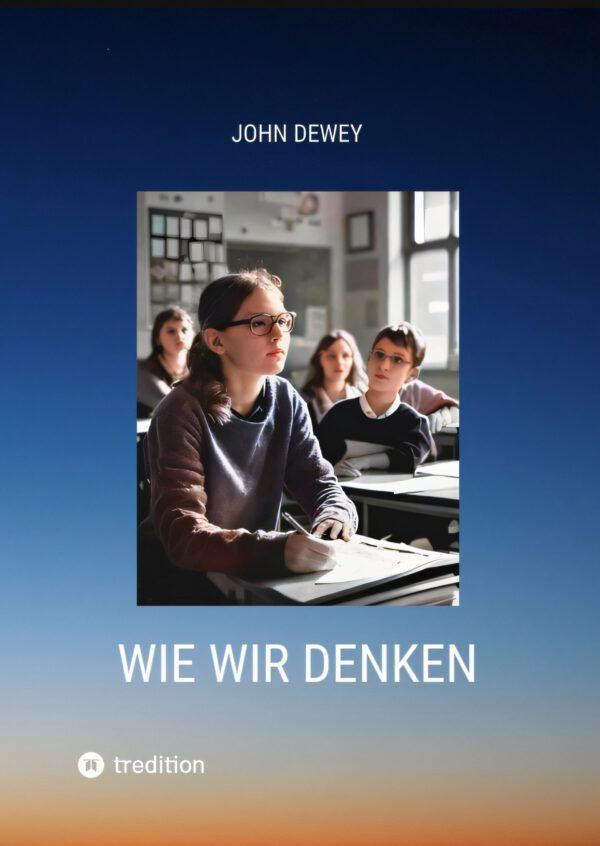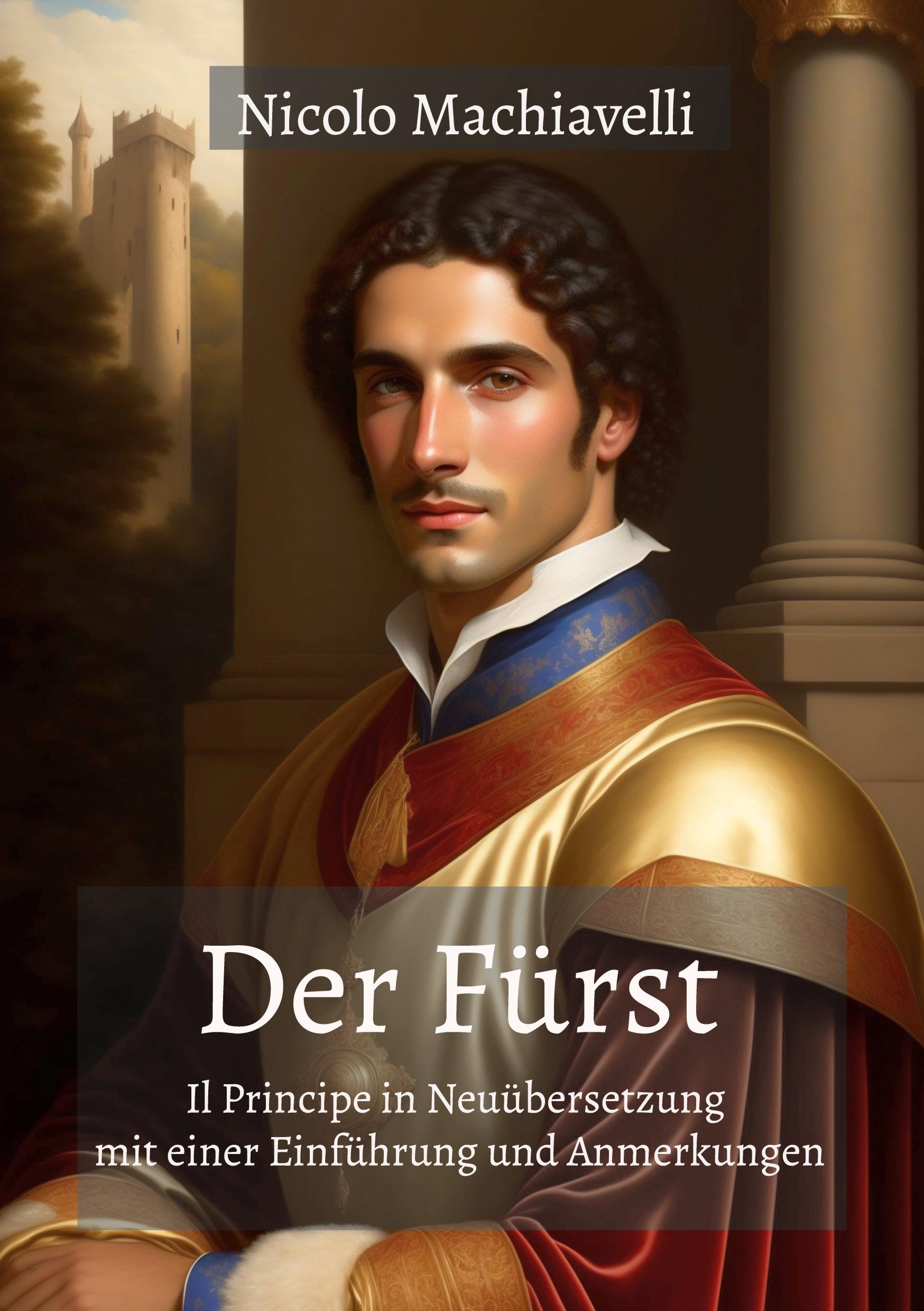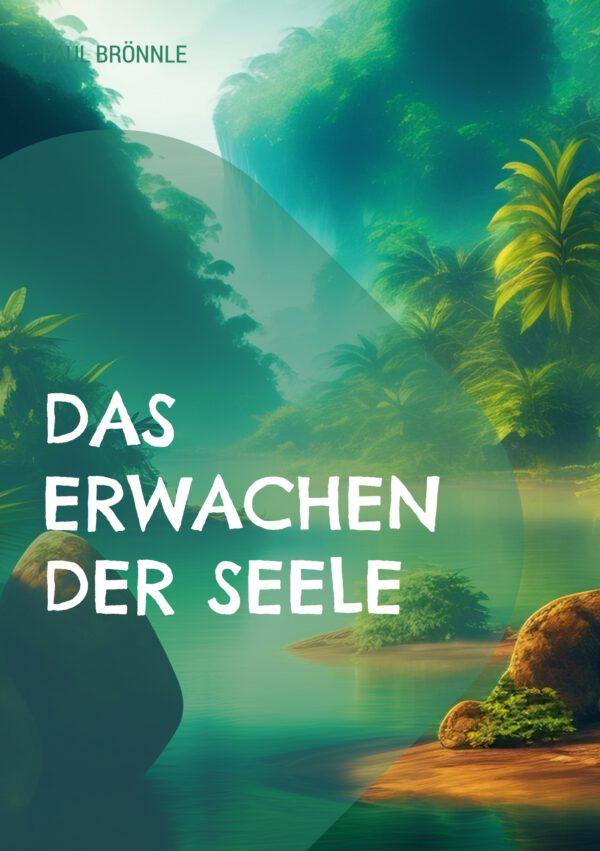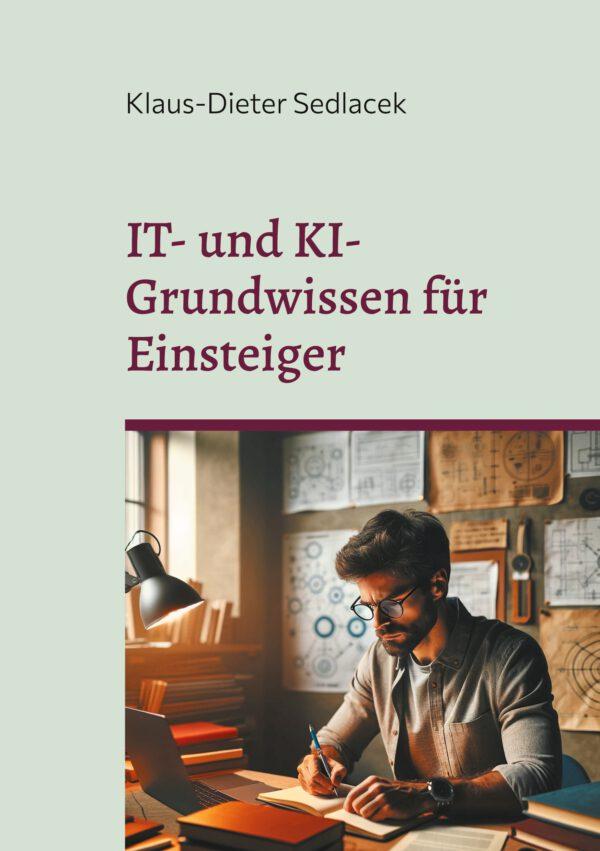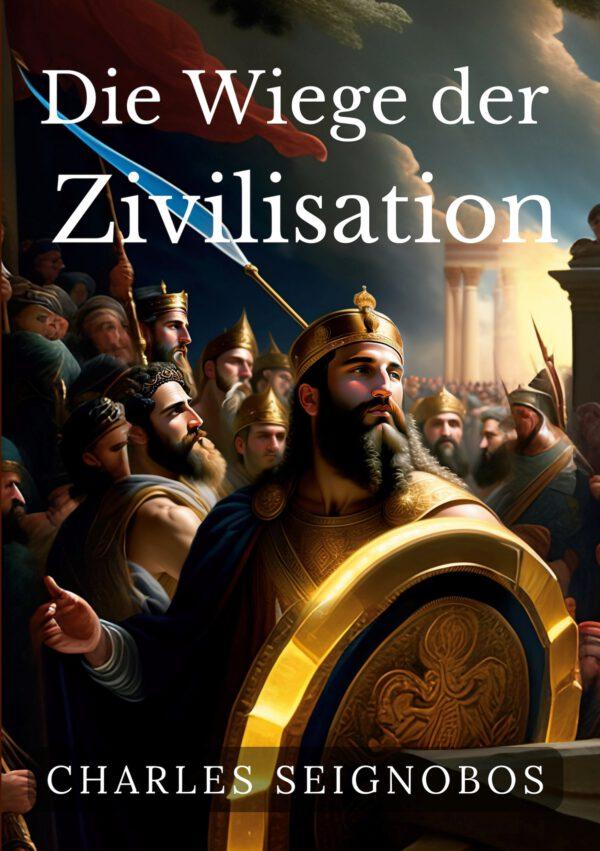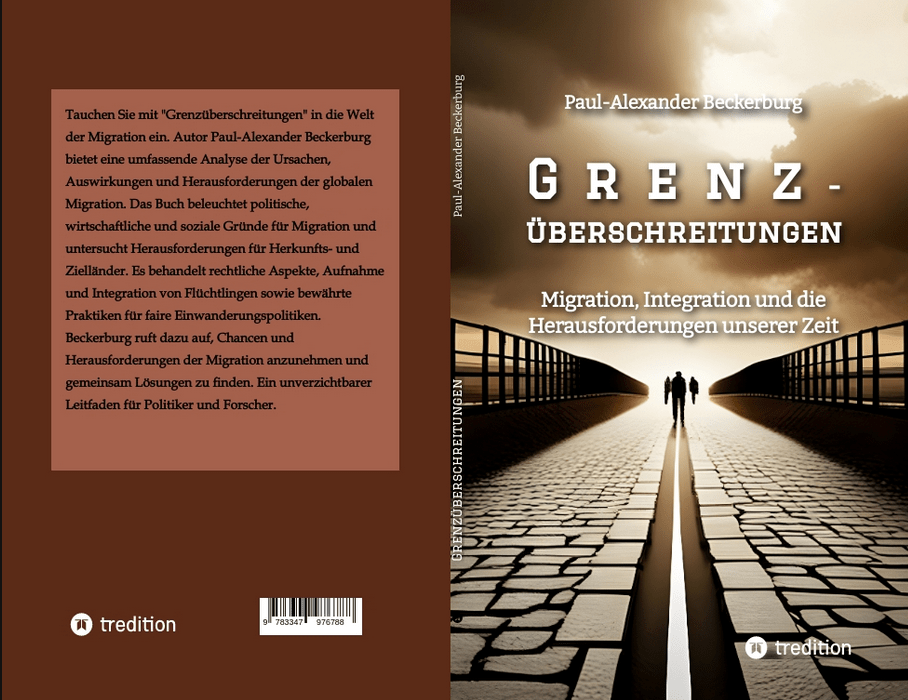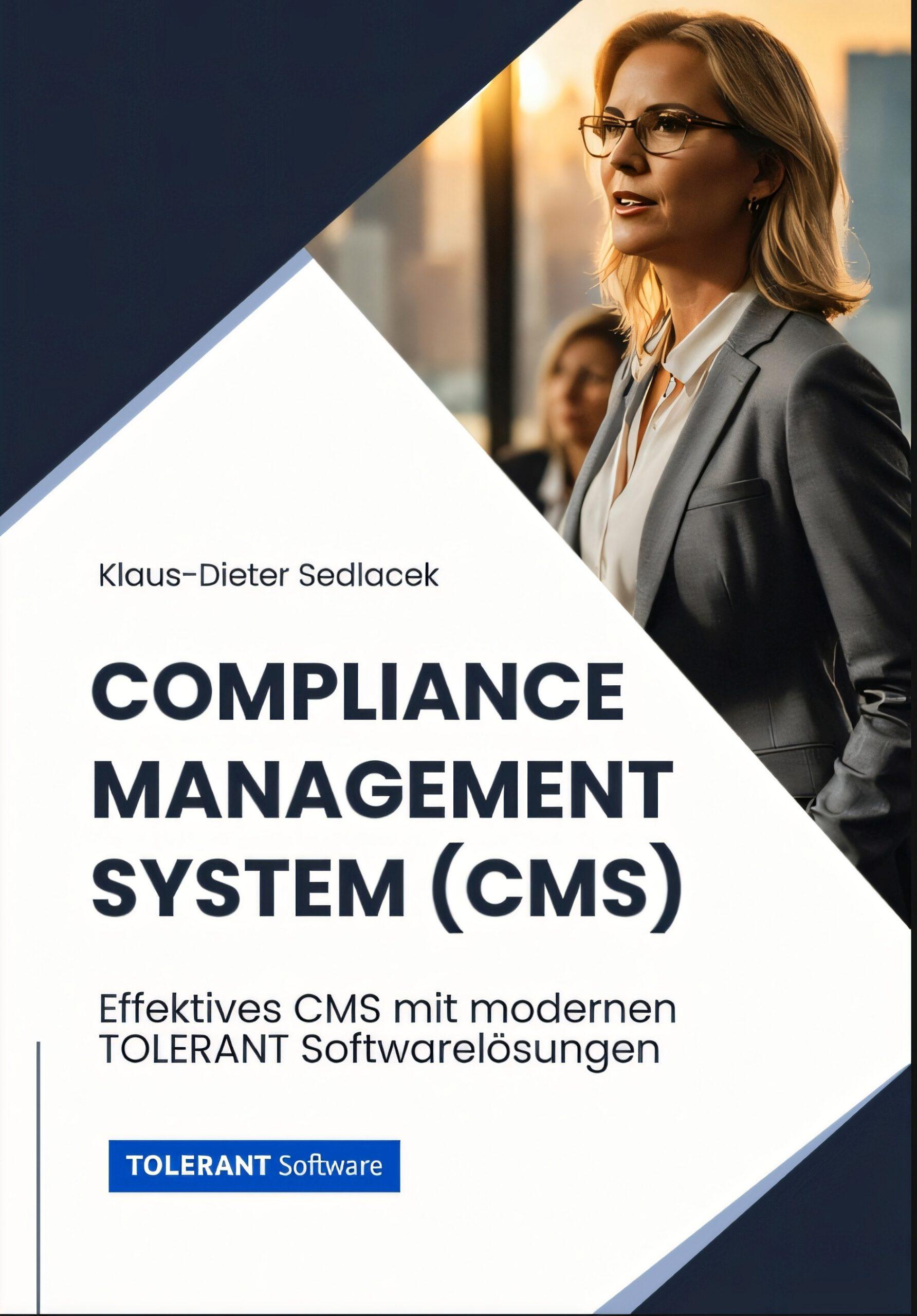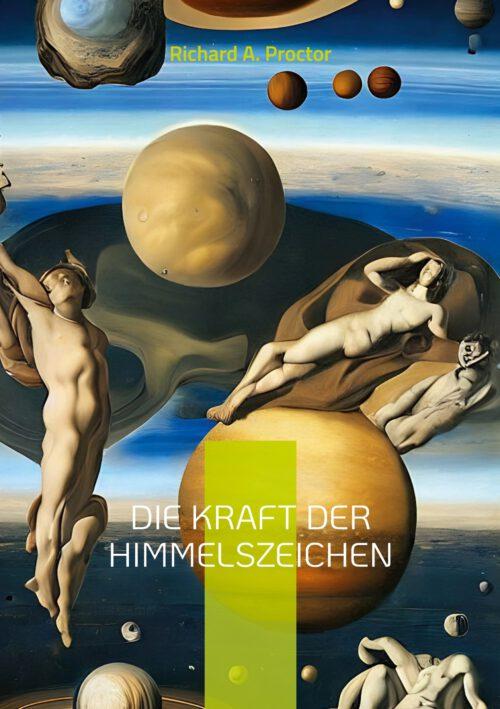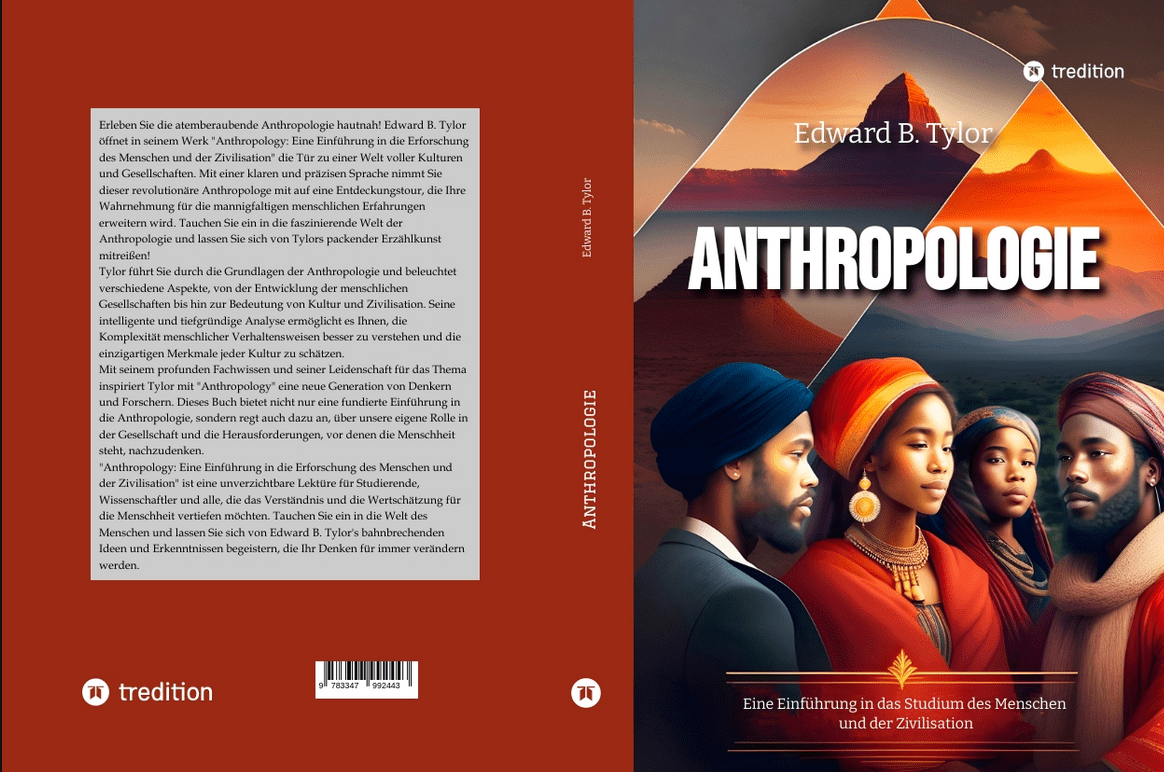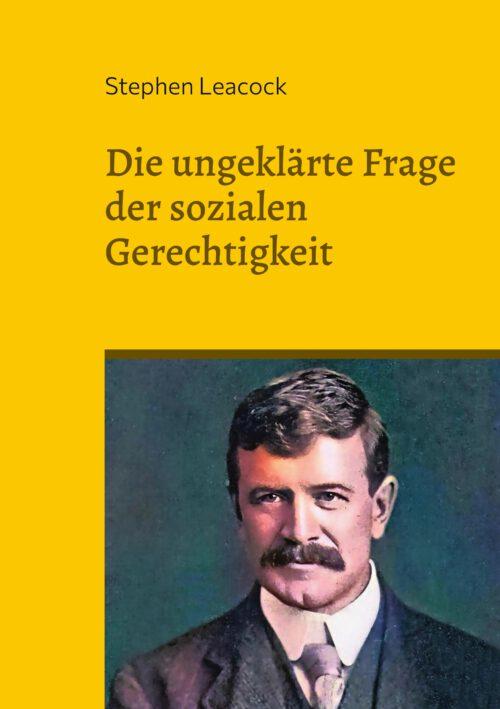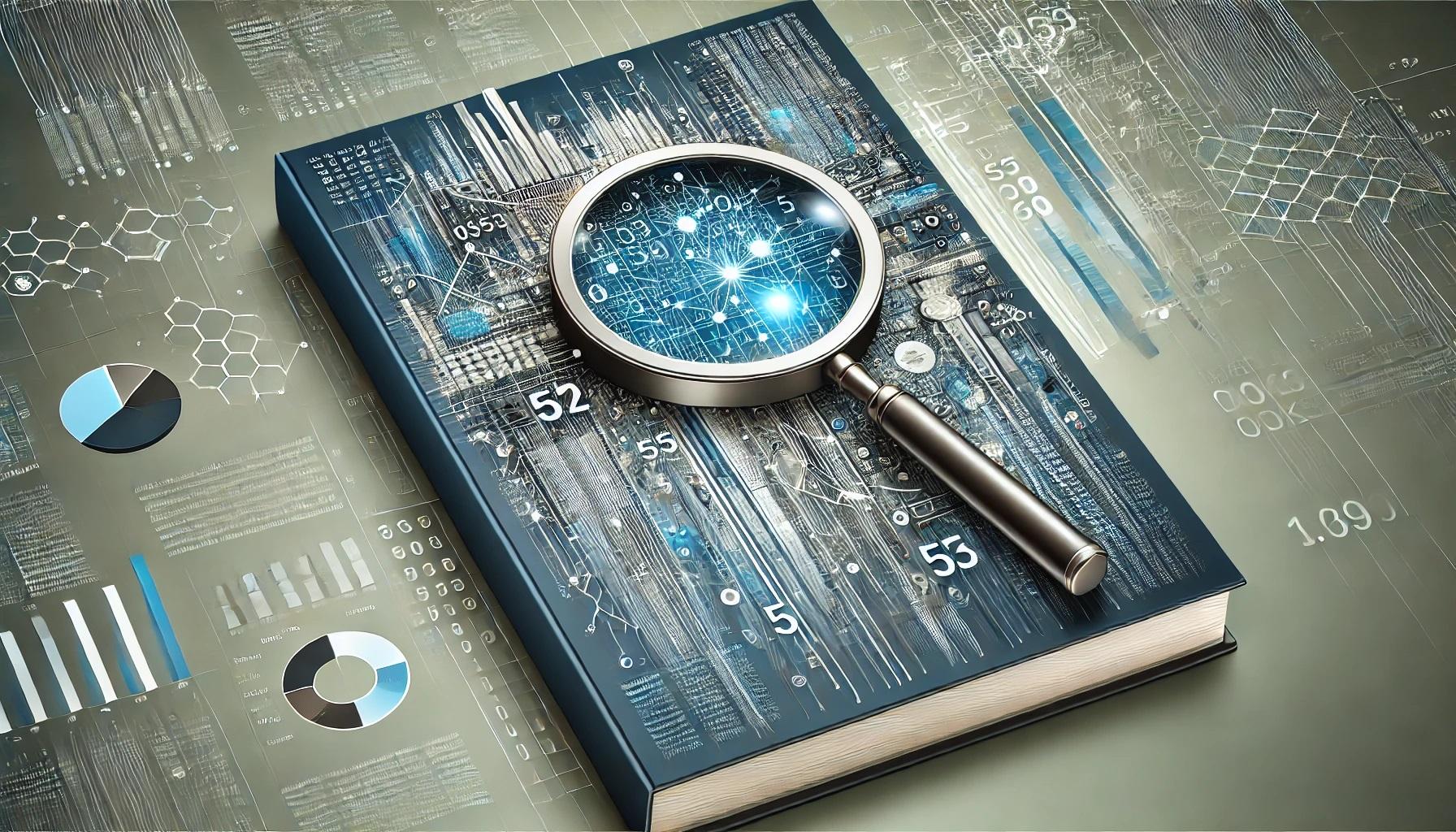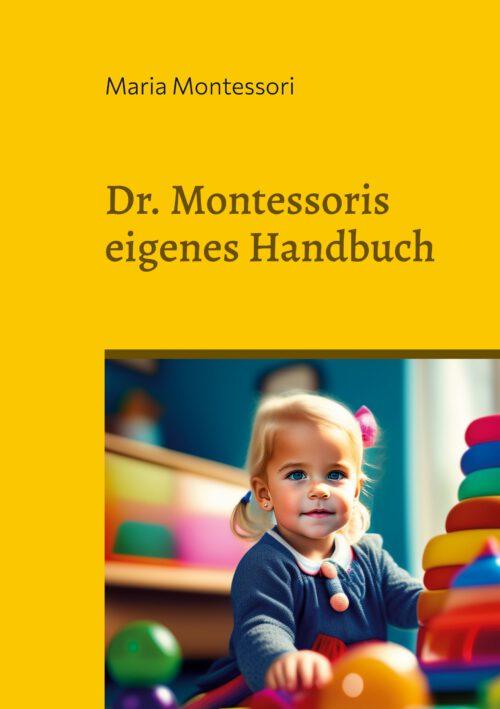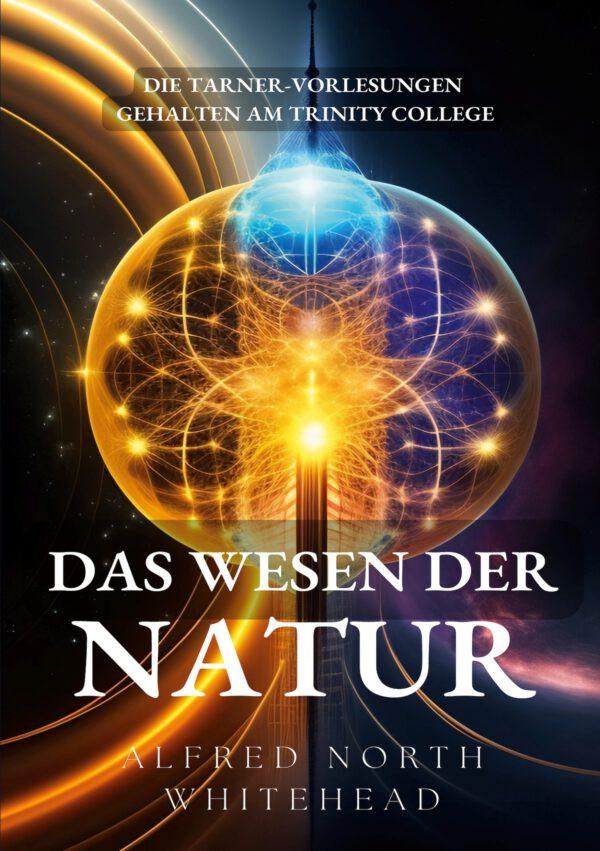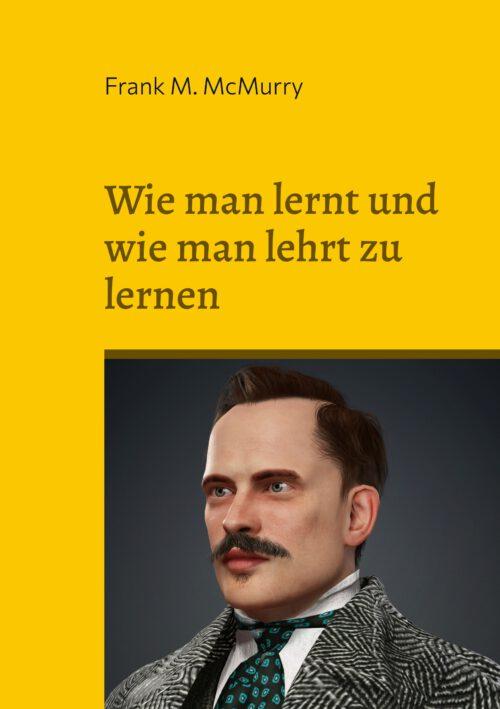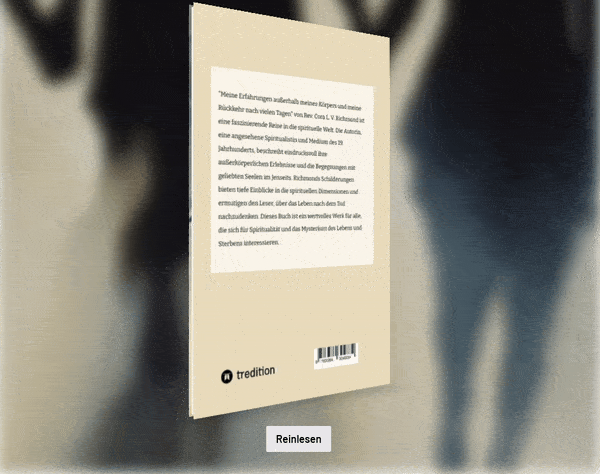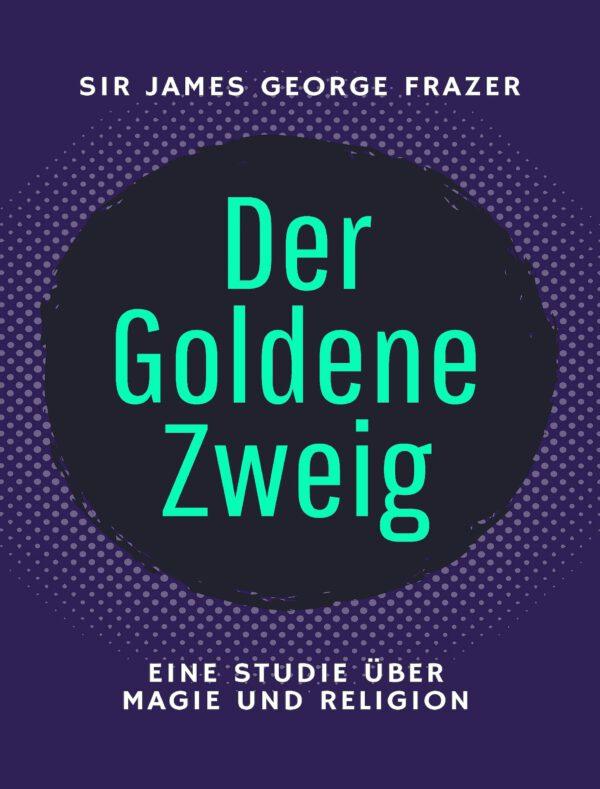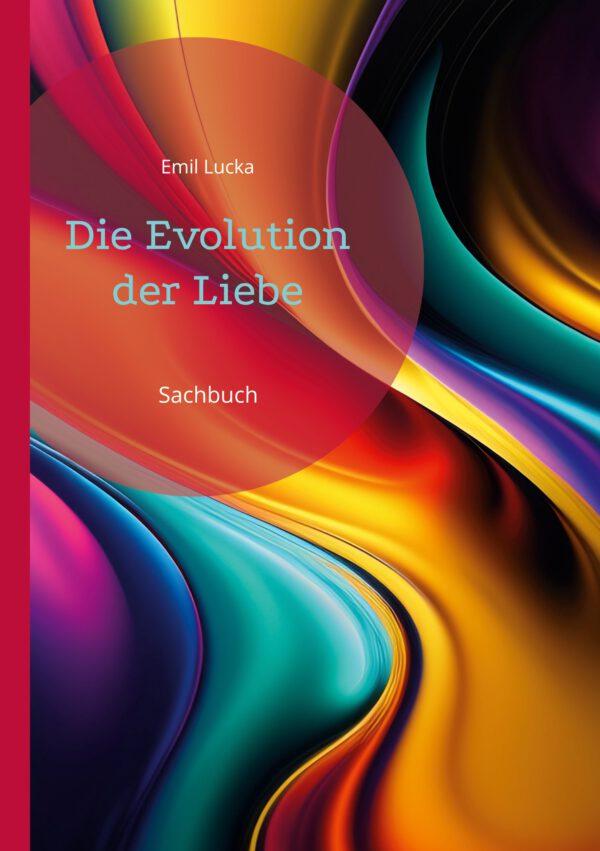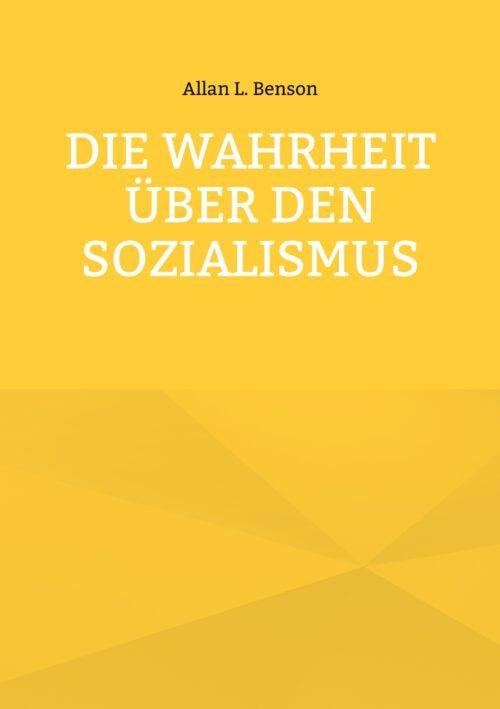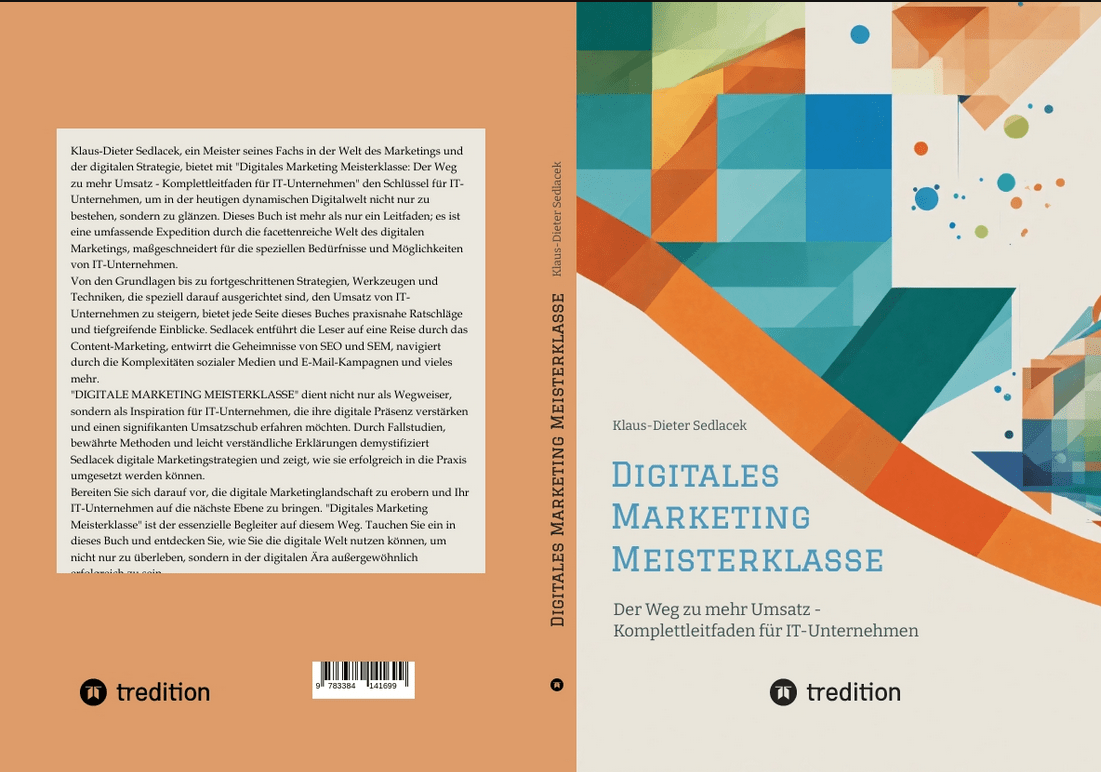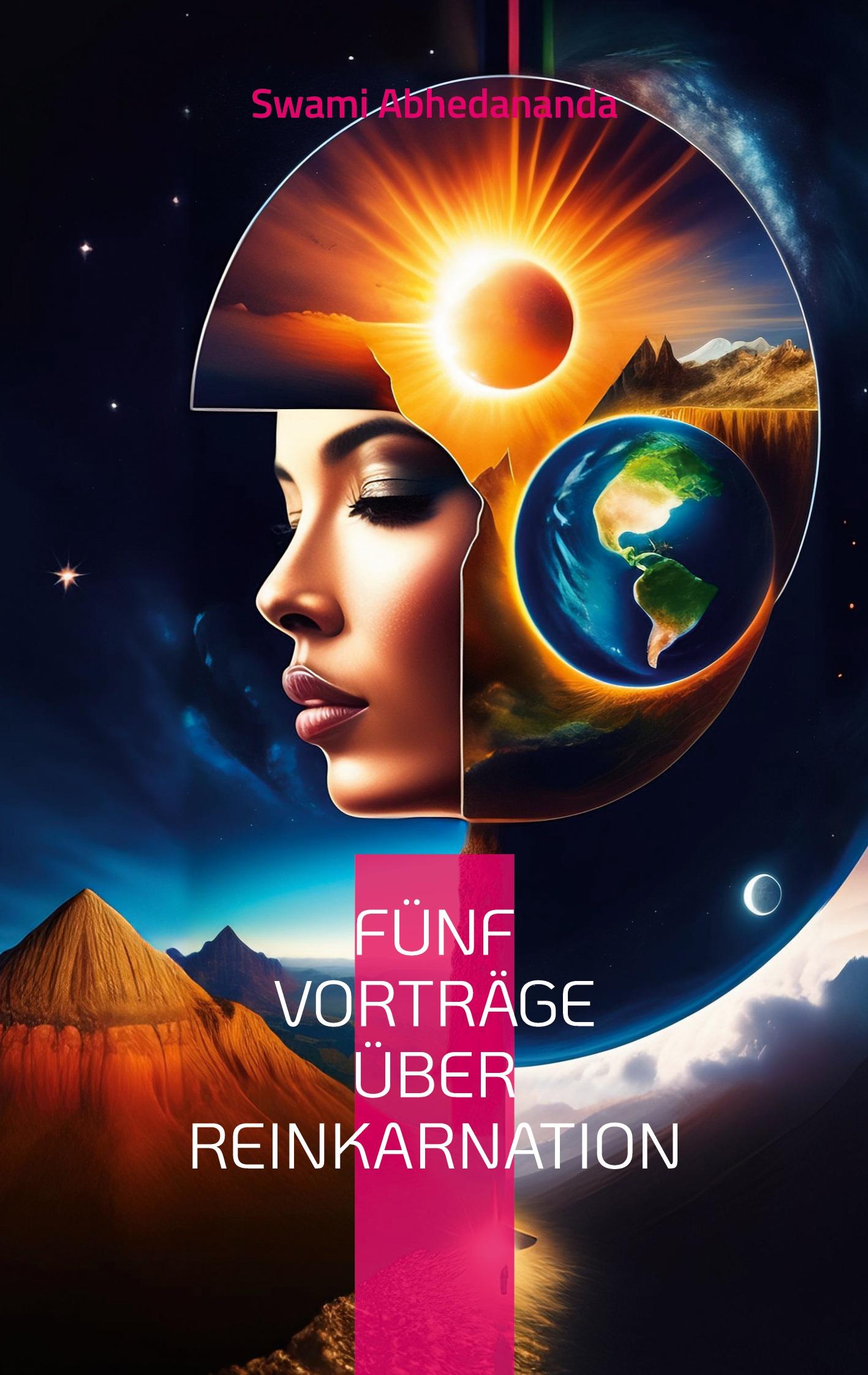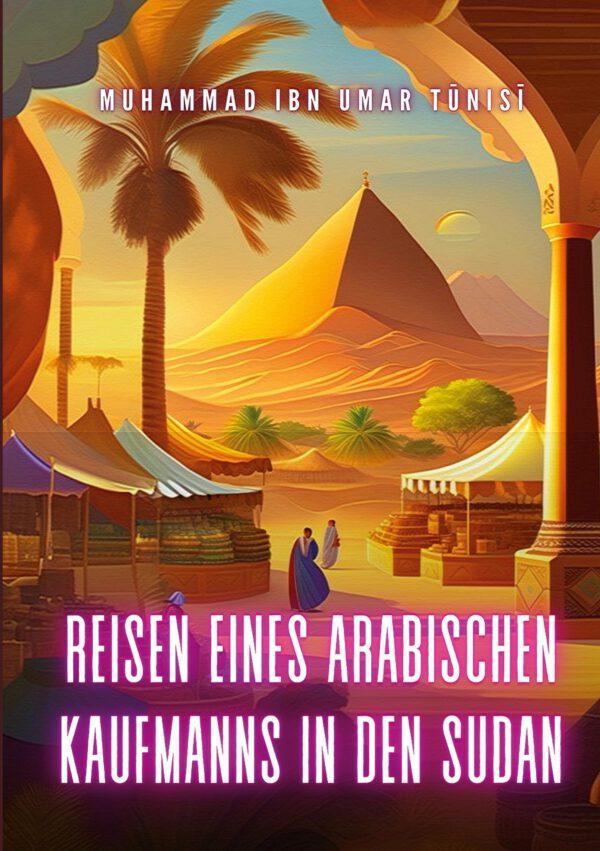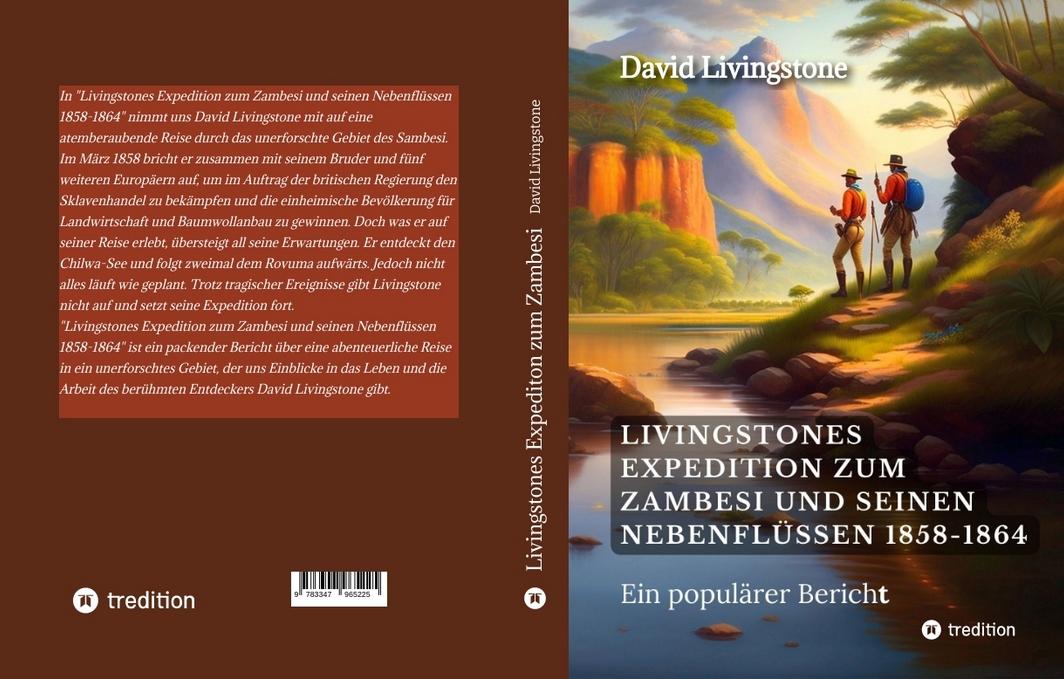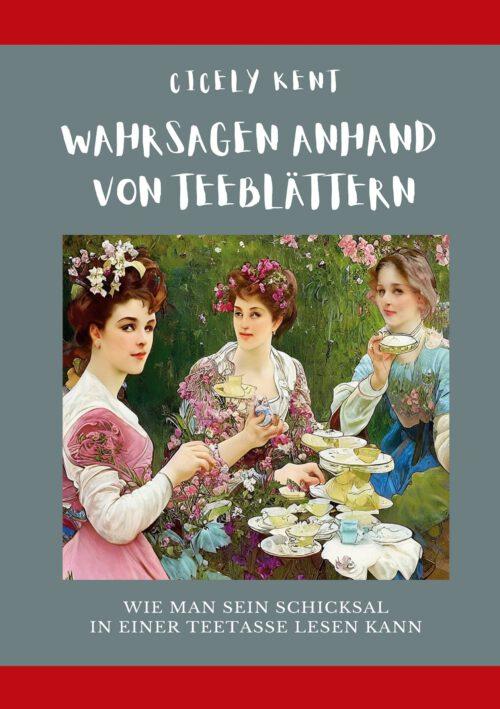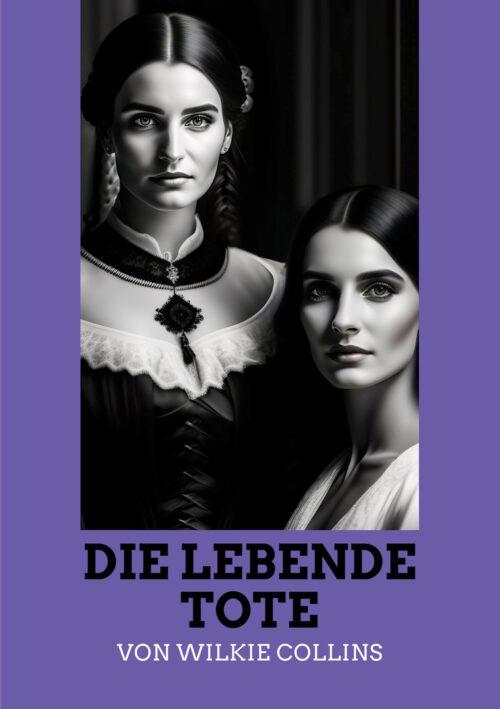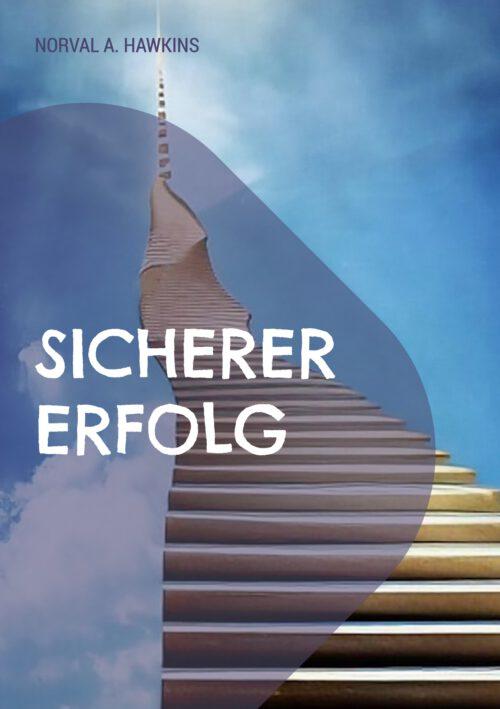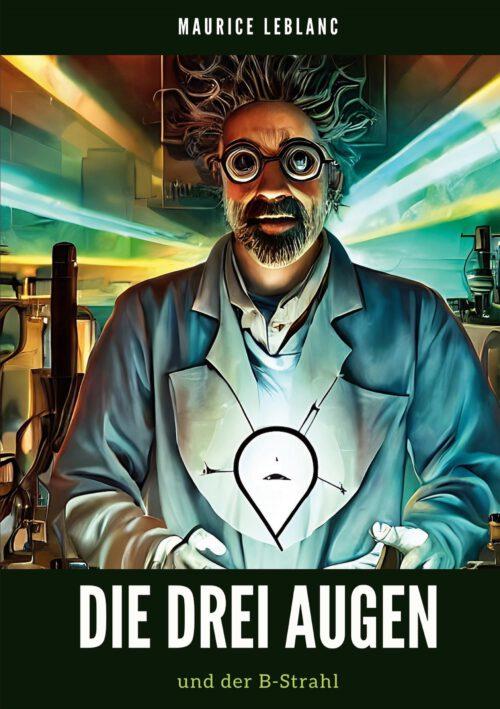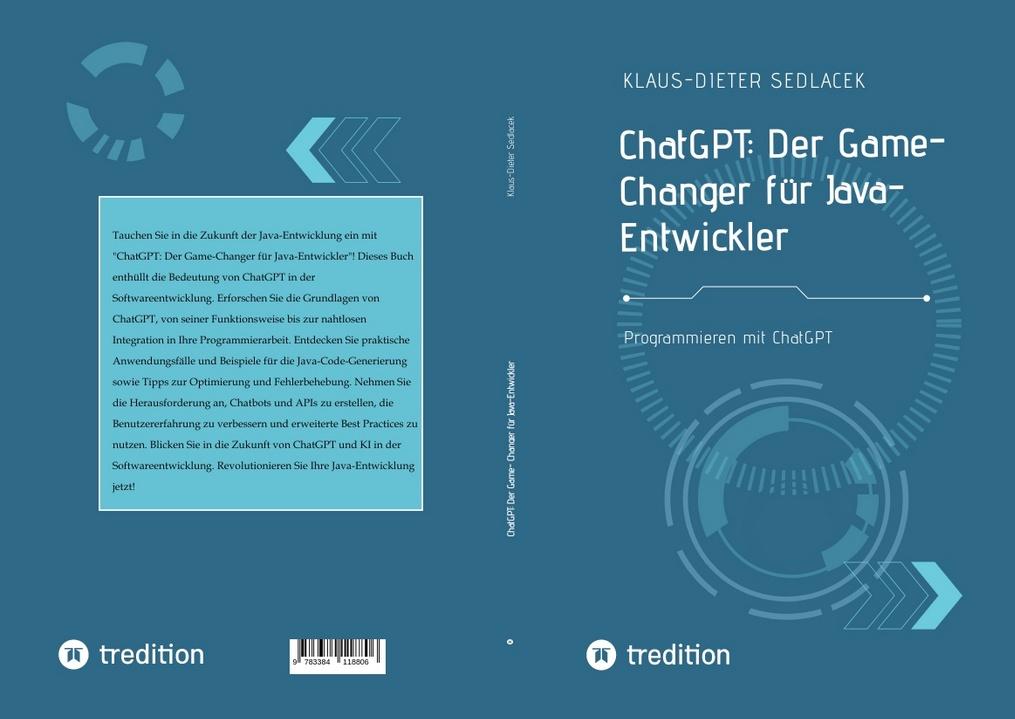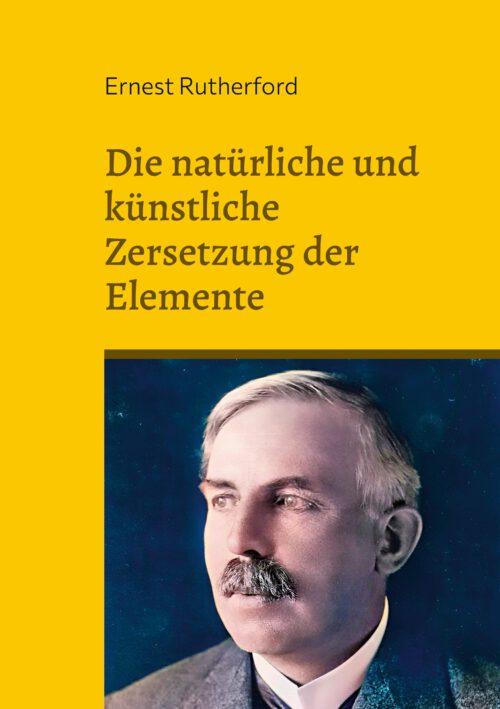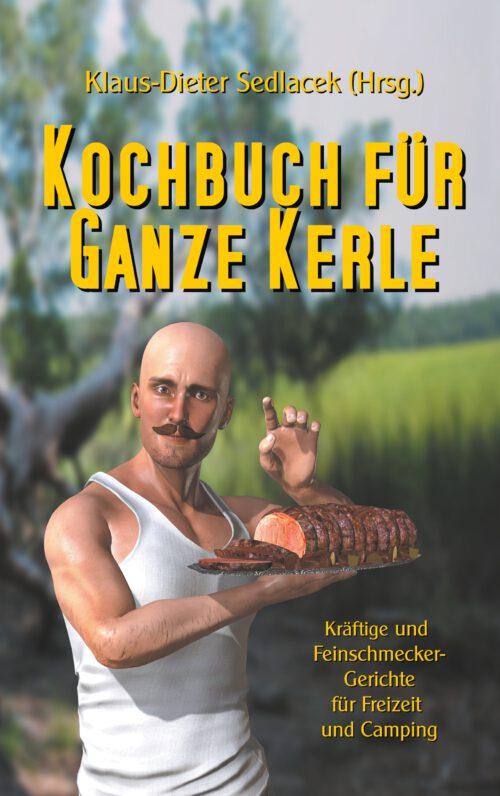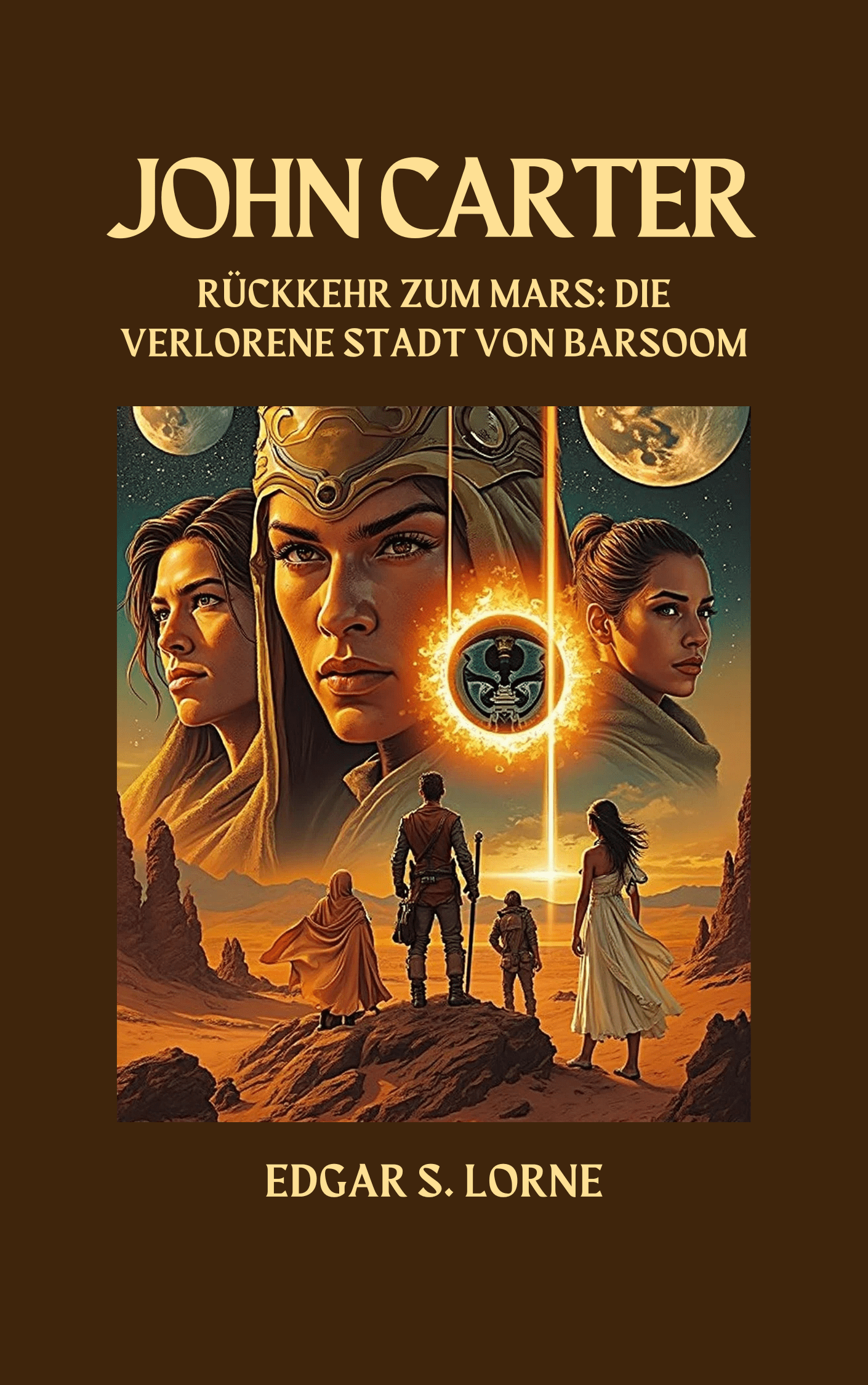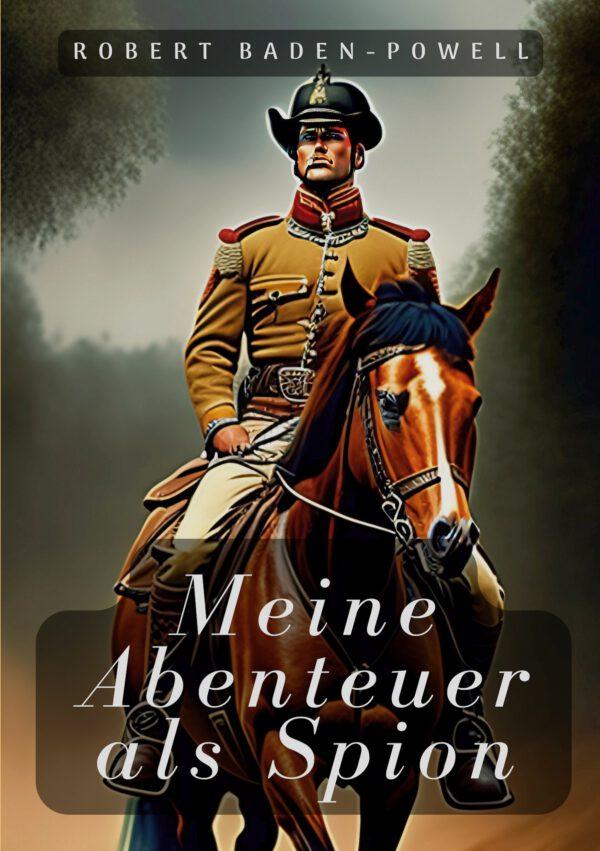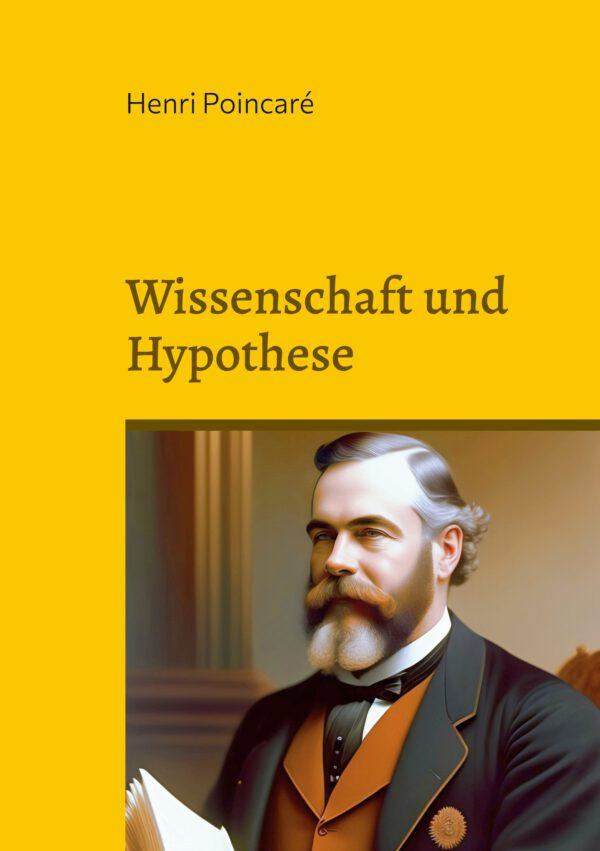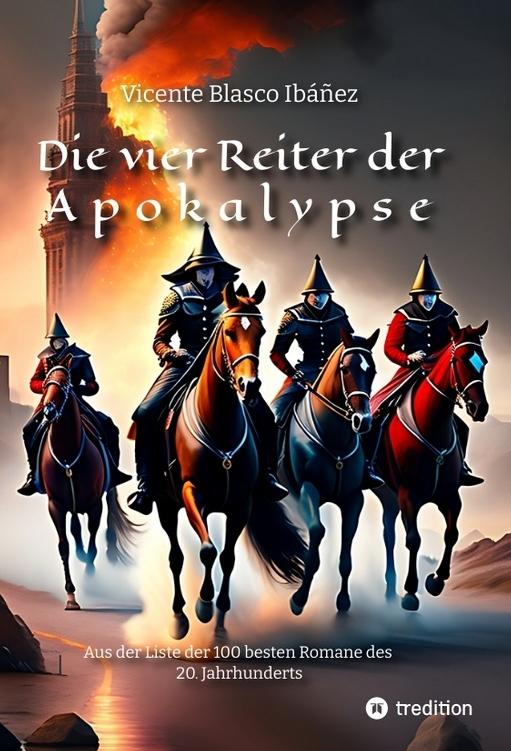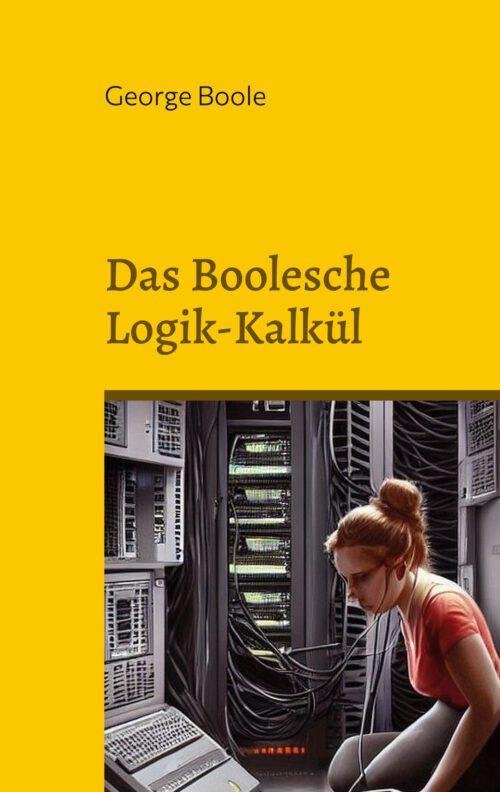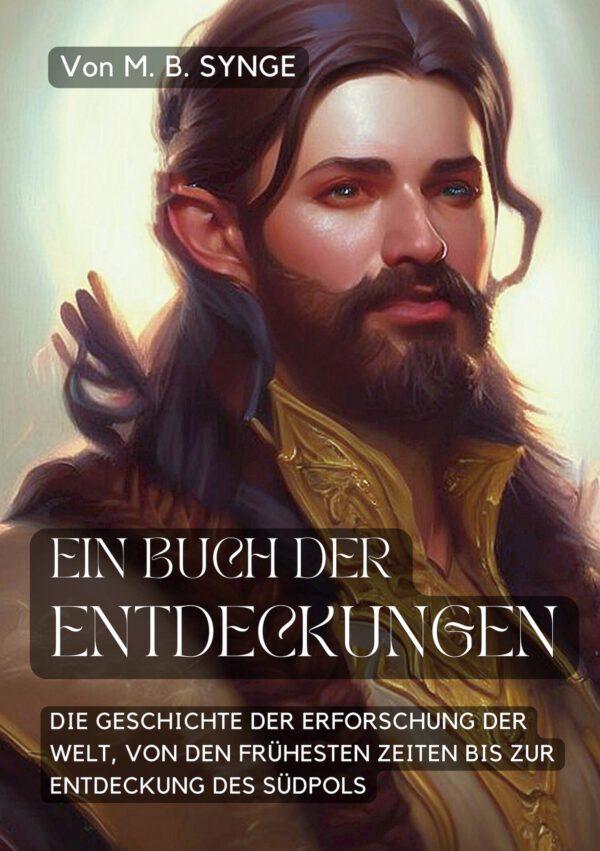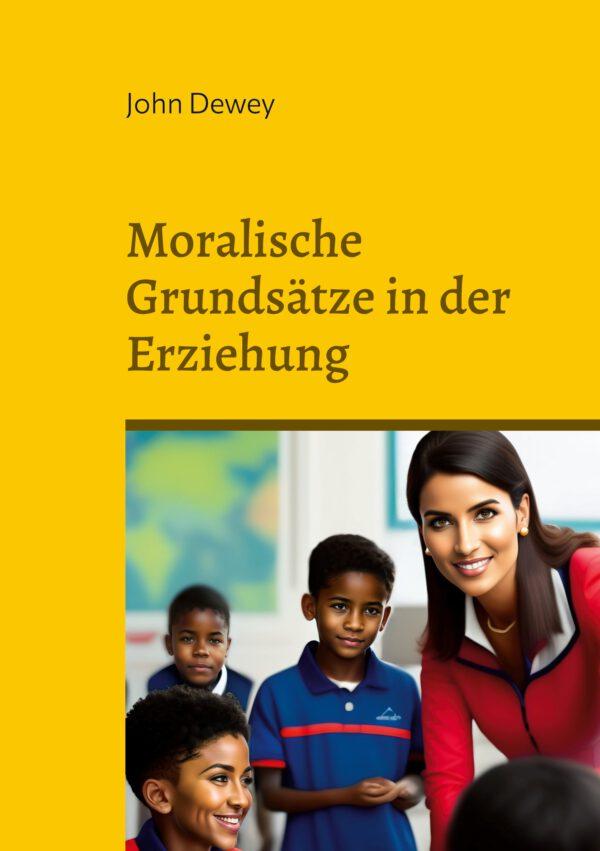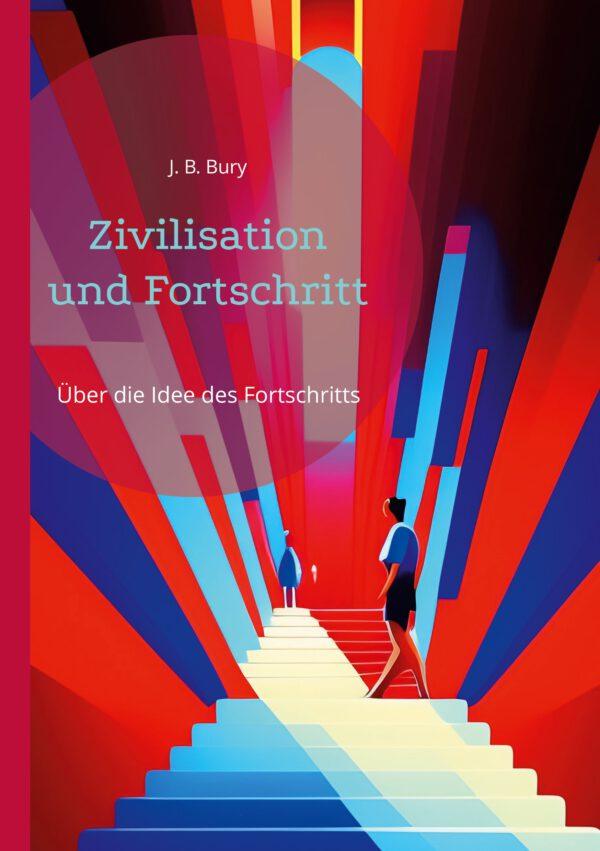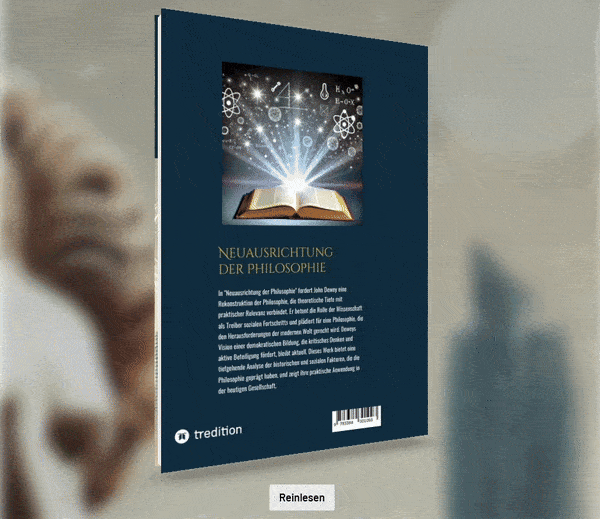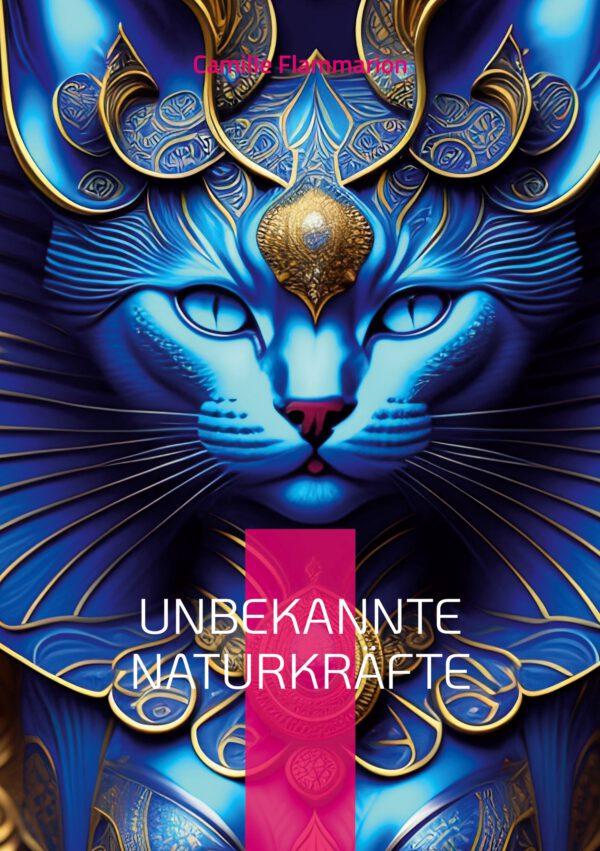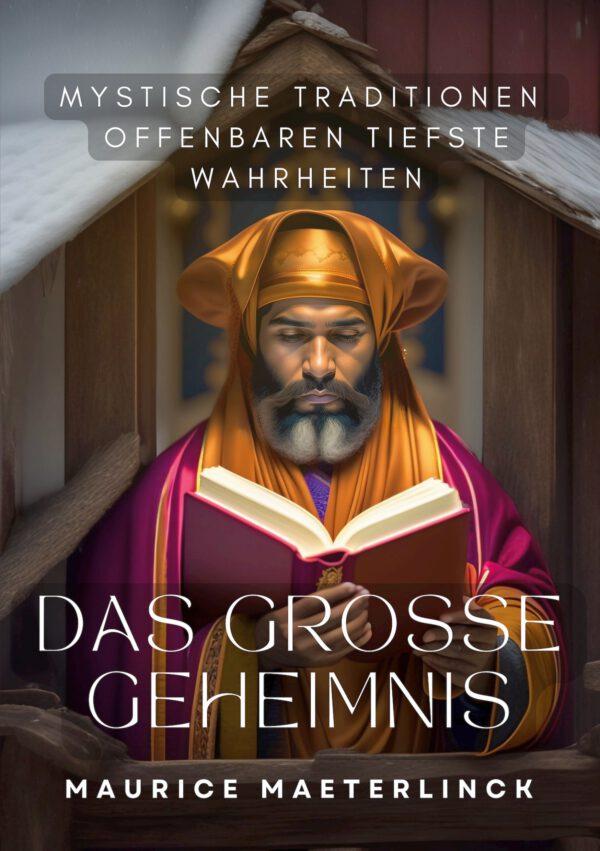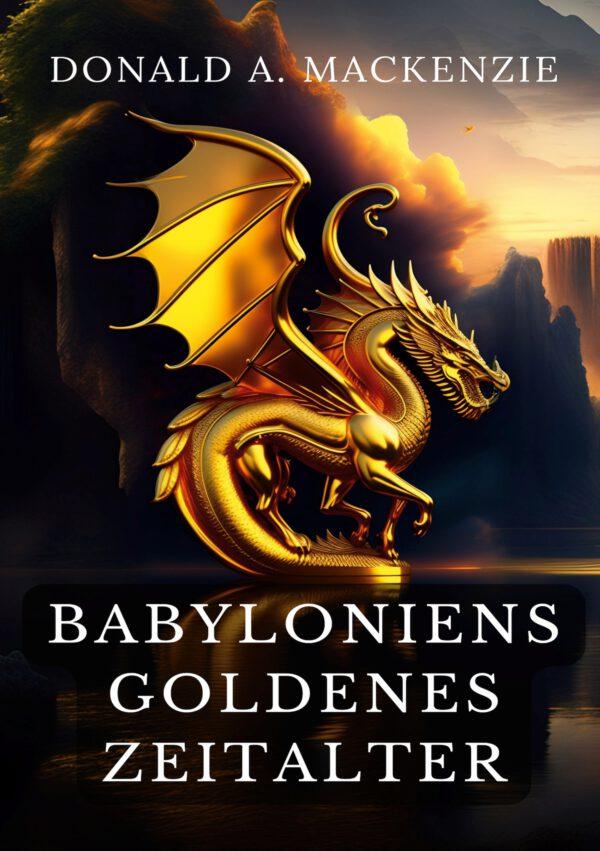Stuttgart, 2010. Die Stadt erlebt einen Aufschrei seiner Bürger. Das ambitionierte Projekt „Stuttgart 21“, das den Umbau des Hauptbahnhofs und die Verlegung der Bahntrasse in einen Tunnel vorsieht, polarisiert die Meinungen. Unterstützer sehen in dem Großprojekt eine Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur und ein größeres, attraktiveres Stadtbild. Kritiker hingegen fürchten den Verlust historischer Substanz und massive Eingriffe in die Natur.
Die ersten Bagger rollen an, und die Schwaben stehen Spalier. Demonstrationen, die anfangs aus wenigen engagierten Bürgern bestehen, wachsen schnell zu Massenprotesten. „Wir sind das Volk!“, hallt es durch die Straßen. Die Bewegung „Stuttgart 21“ wird zum Symbol für Bürgerengagement und das Streben nach Mitbestimmung. Tausende Menschen finden sich im Schlossgarten ein, um gegen den Bau zu demonstrieren, und das friedliche Bild wird durch die brutalen Szenen der Polizei, die am 30. September 2010 auf die friedlichen Protestierenden einprügelt, überschattet.
Dieser Vorfall, bekannt als „Schwarzer Donnerstag“, entzündet die Gemüter weiter. International berichtet die Presse über Stuttgarts Aufstand, die Welt schaut gebannt auf die baden-württembergische Landeshauptstadt. Nach jahrelangen Auseinandersetzungen wird die Entscheidung zugunsten des Projekts getroffen, doch die Wunden in der Stadt bleiben.
Stuttgart 21 wird Realität, aber es bleibt ein Denkmal für den Kampf um Bürgerrechte und eine Mahnung, dass jede große Veränderung immer auch Risiken birgt. Die Stadt hat gelernt, dass der Dialog zwischen Politik und Bürgern unerlässlich ist – eine Lektion, die über die Grenzen Stuttgarts hinausstrahlt.