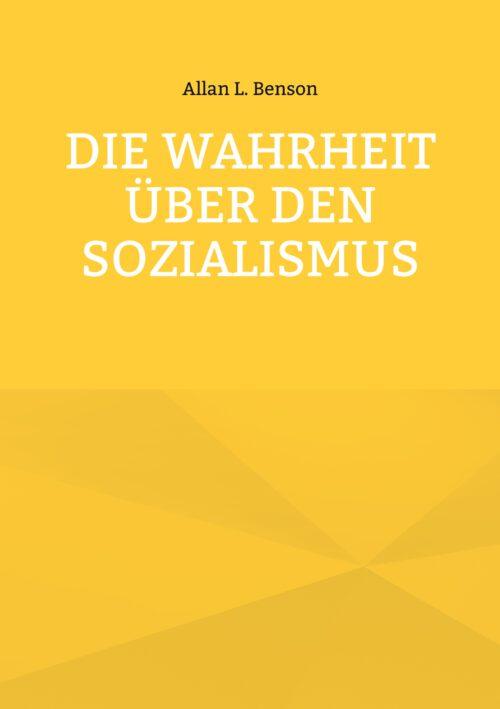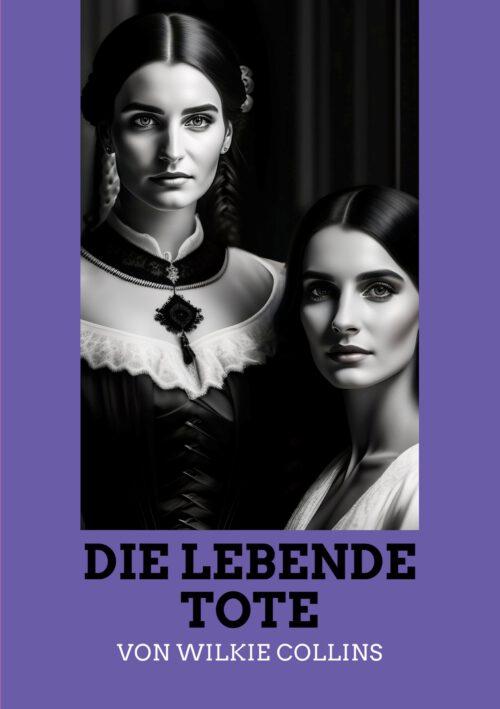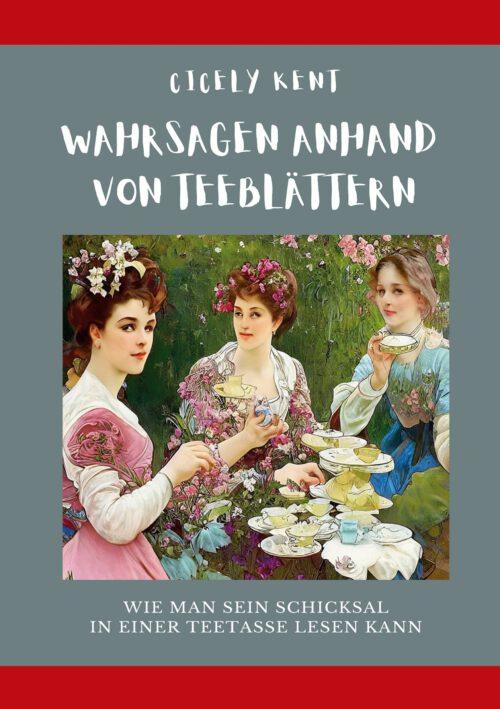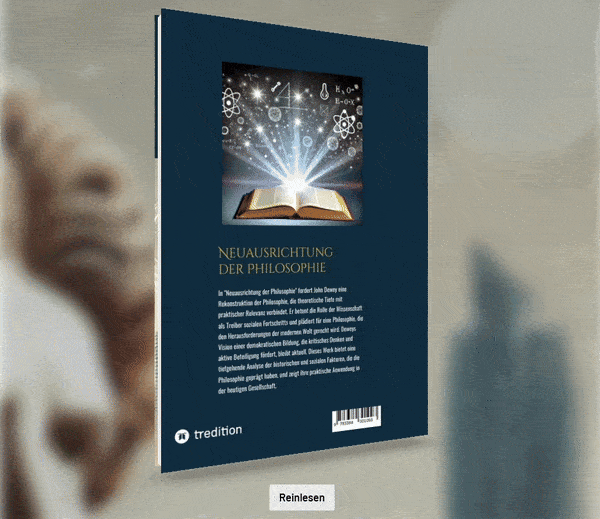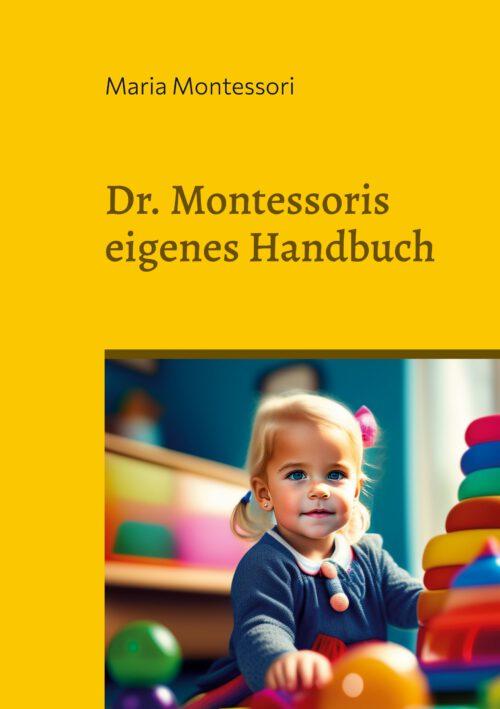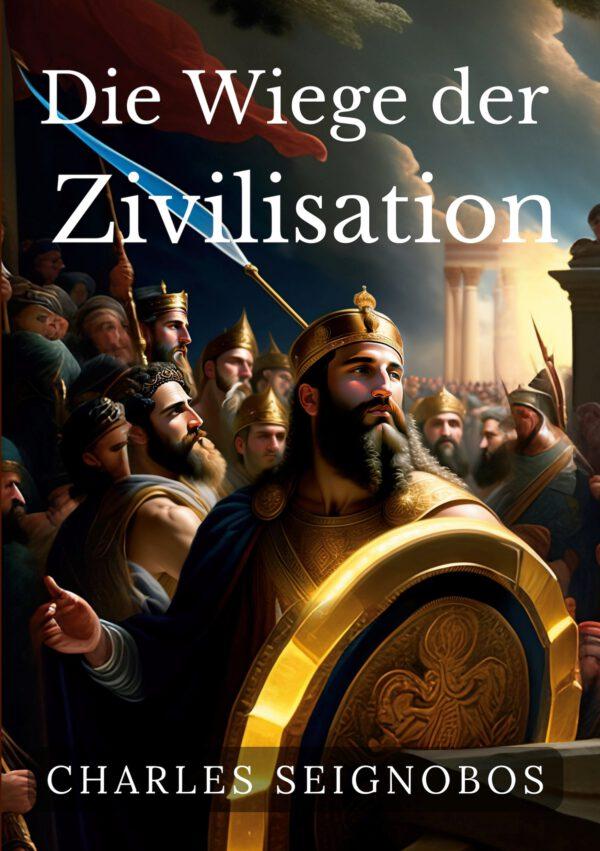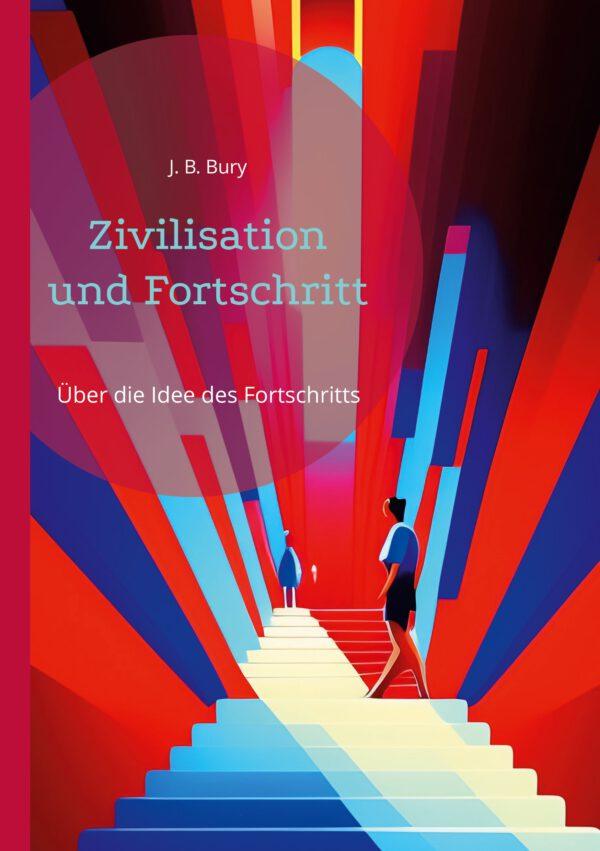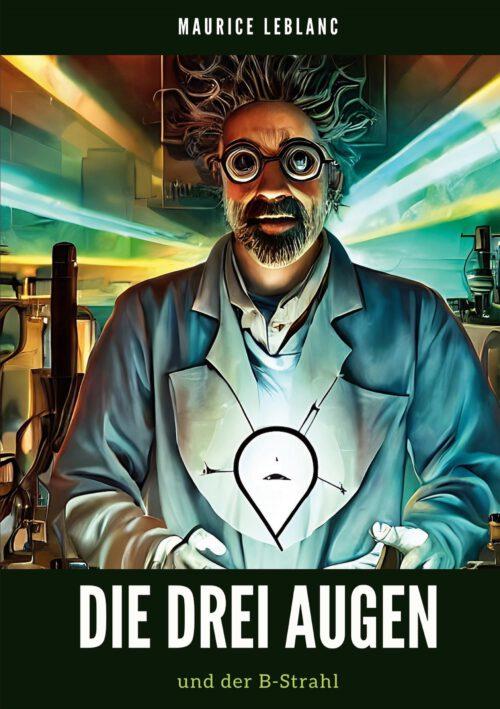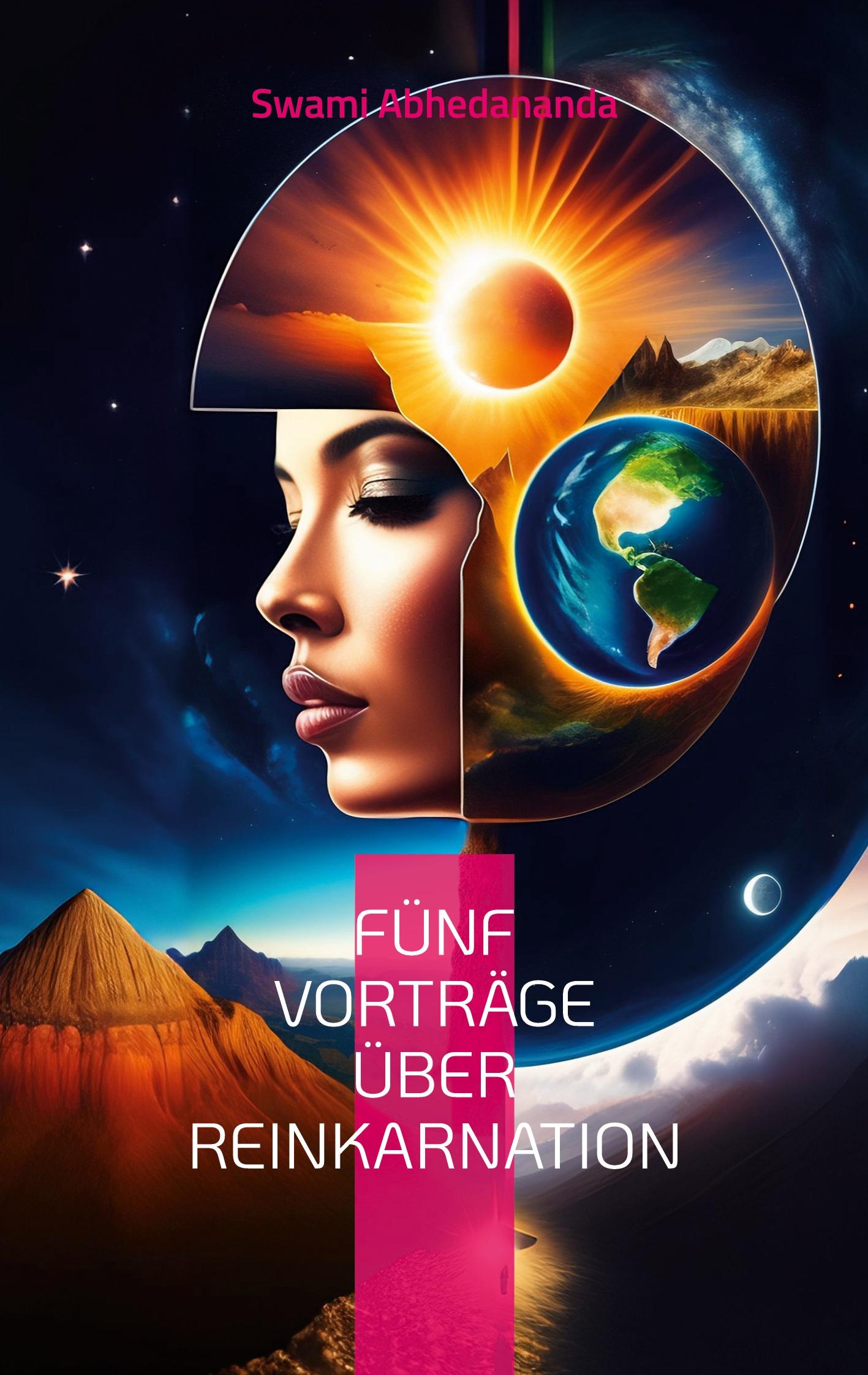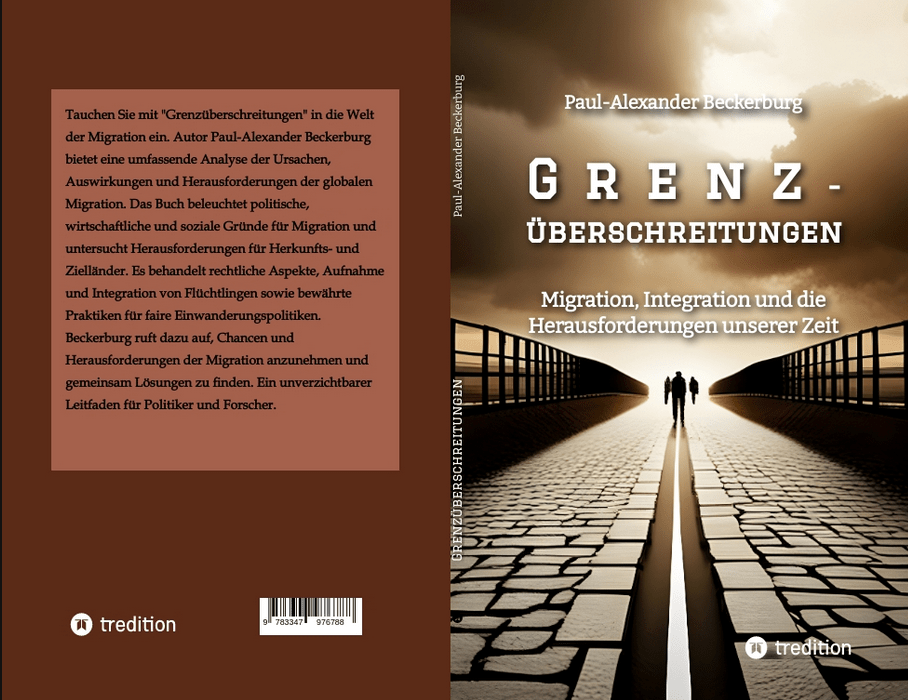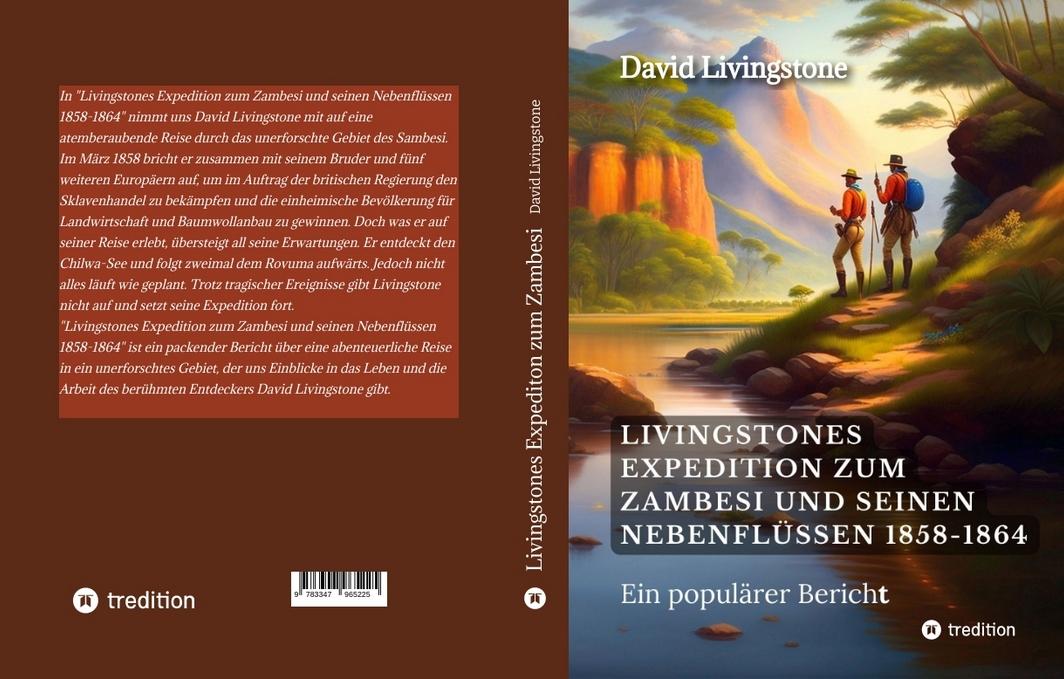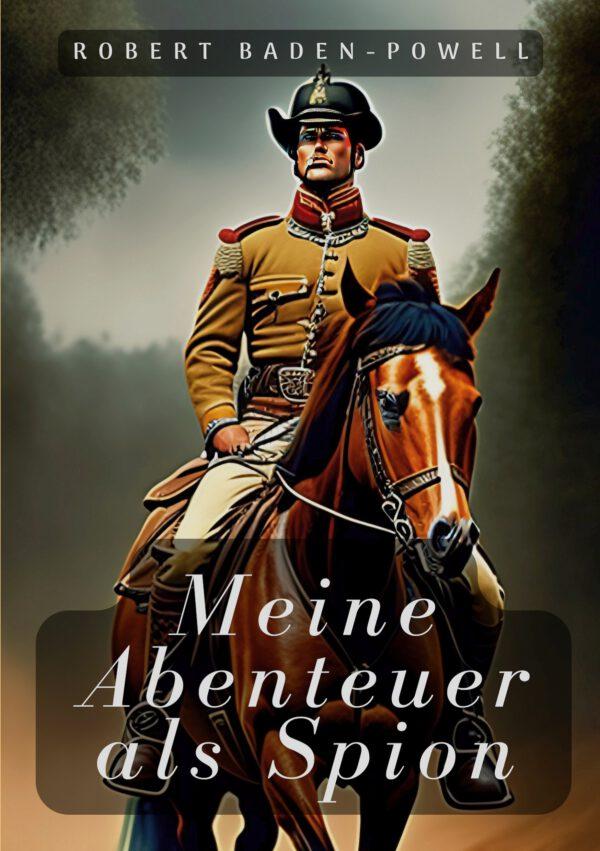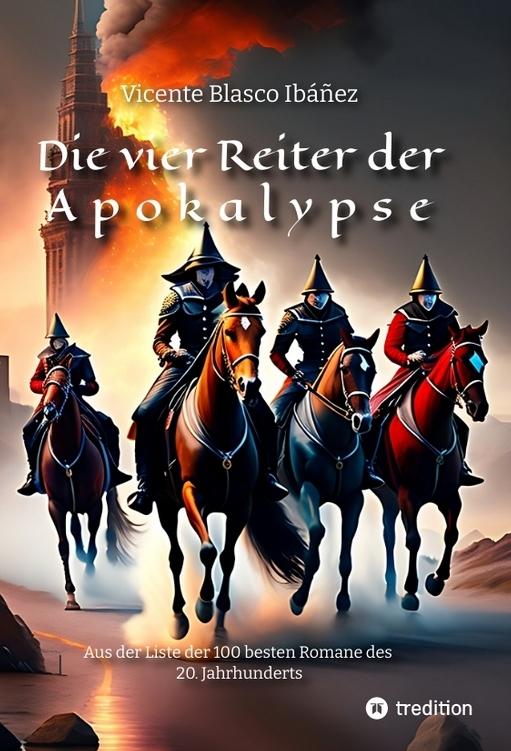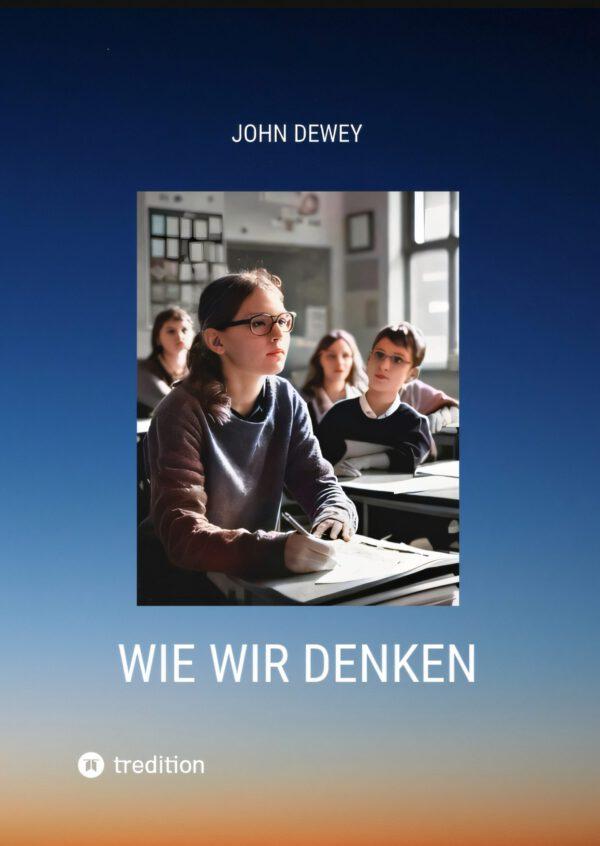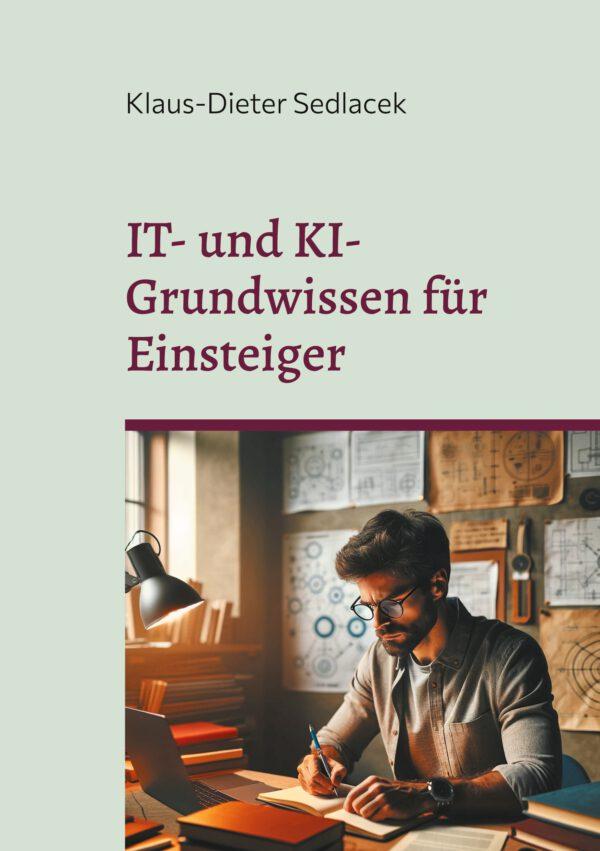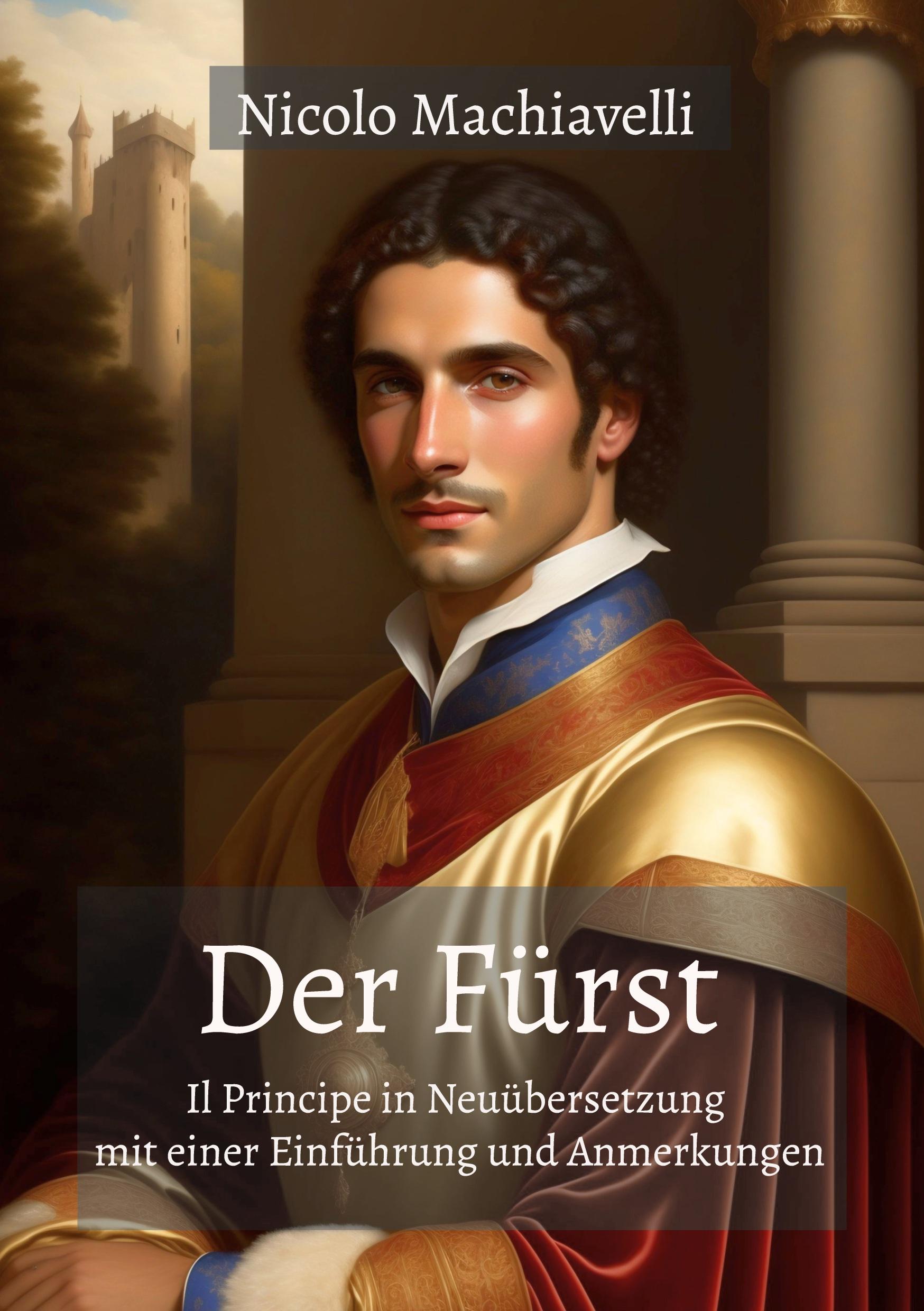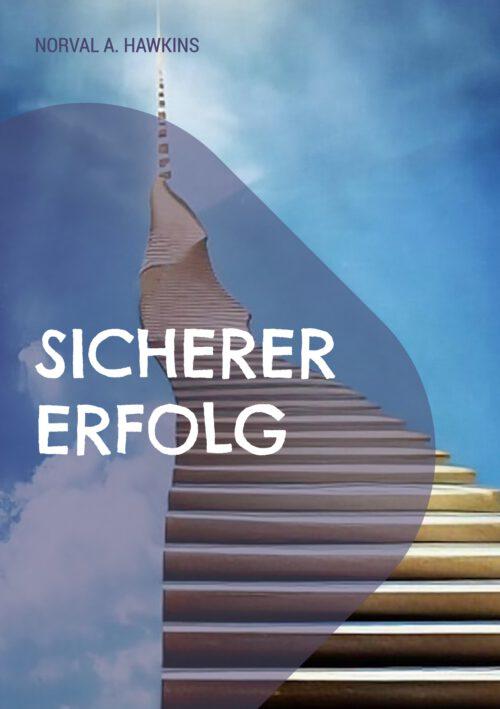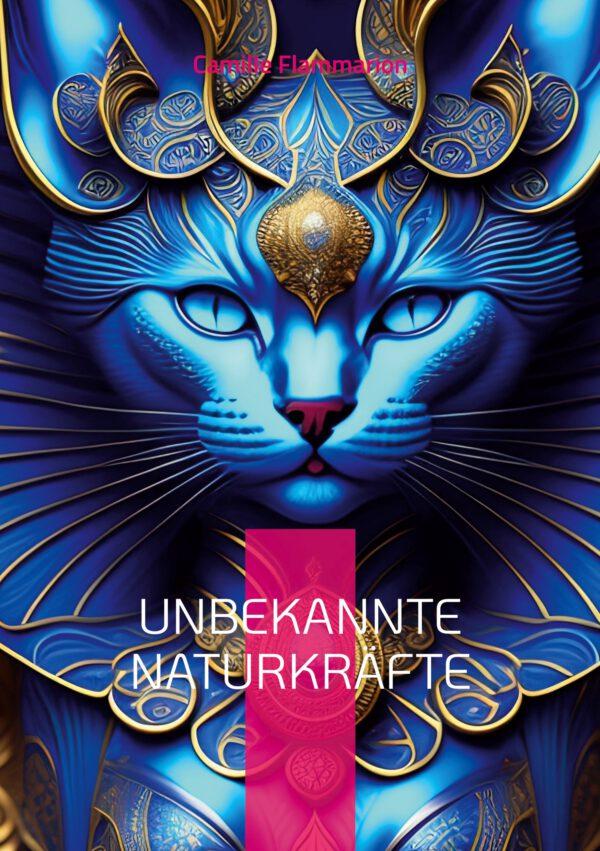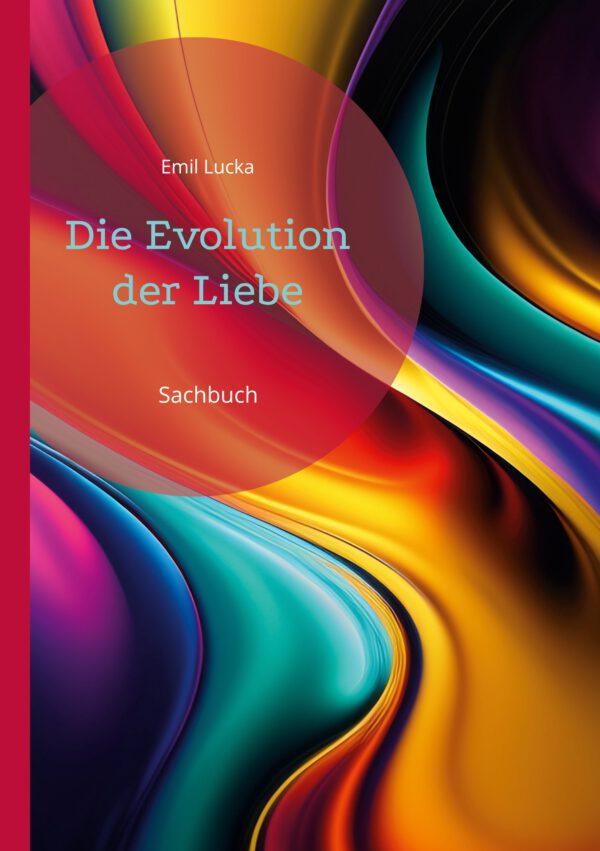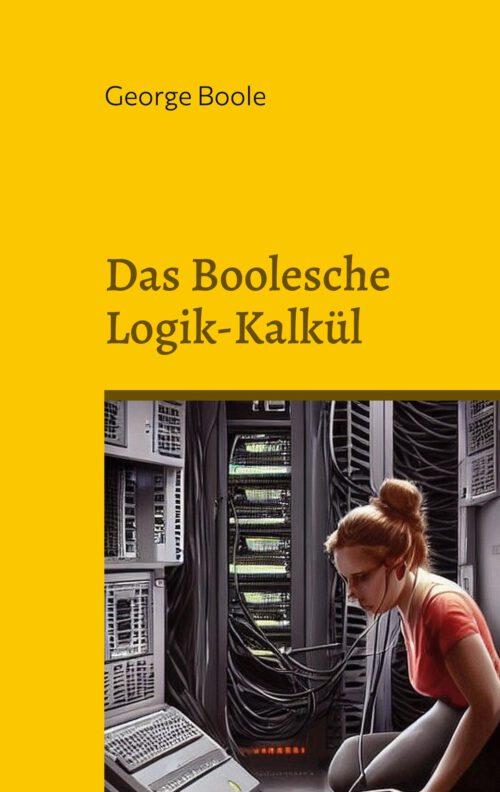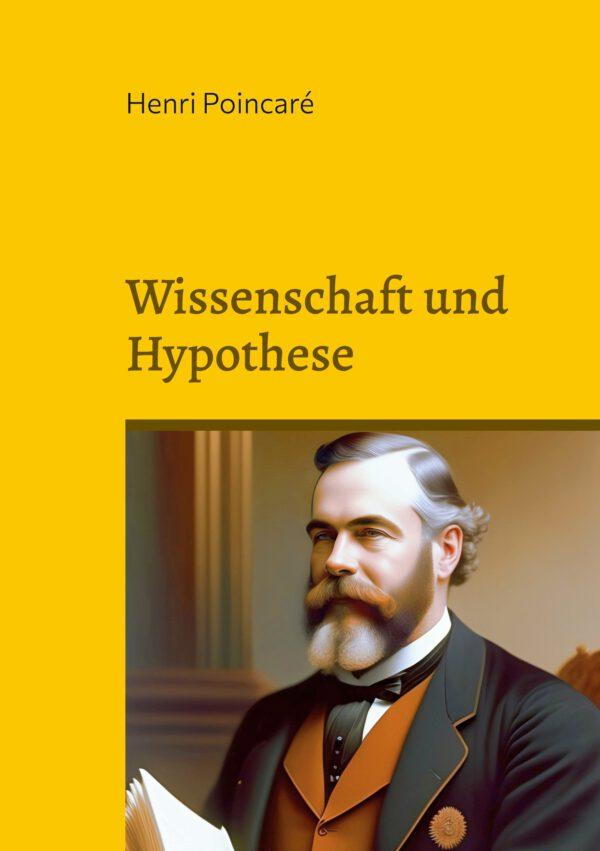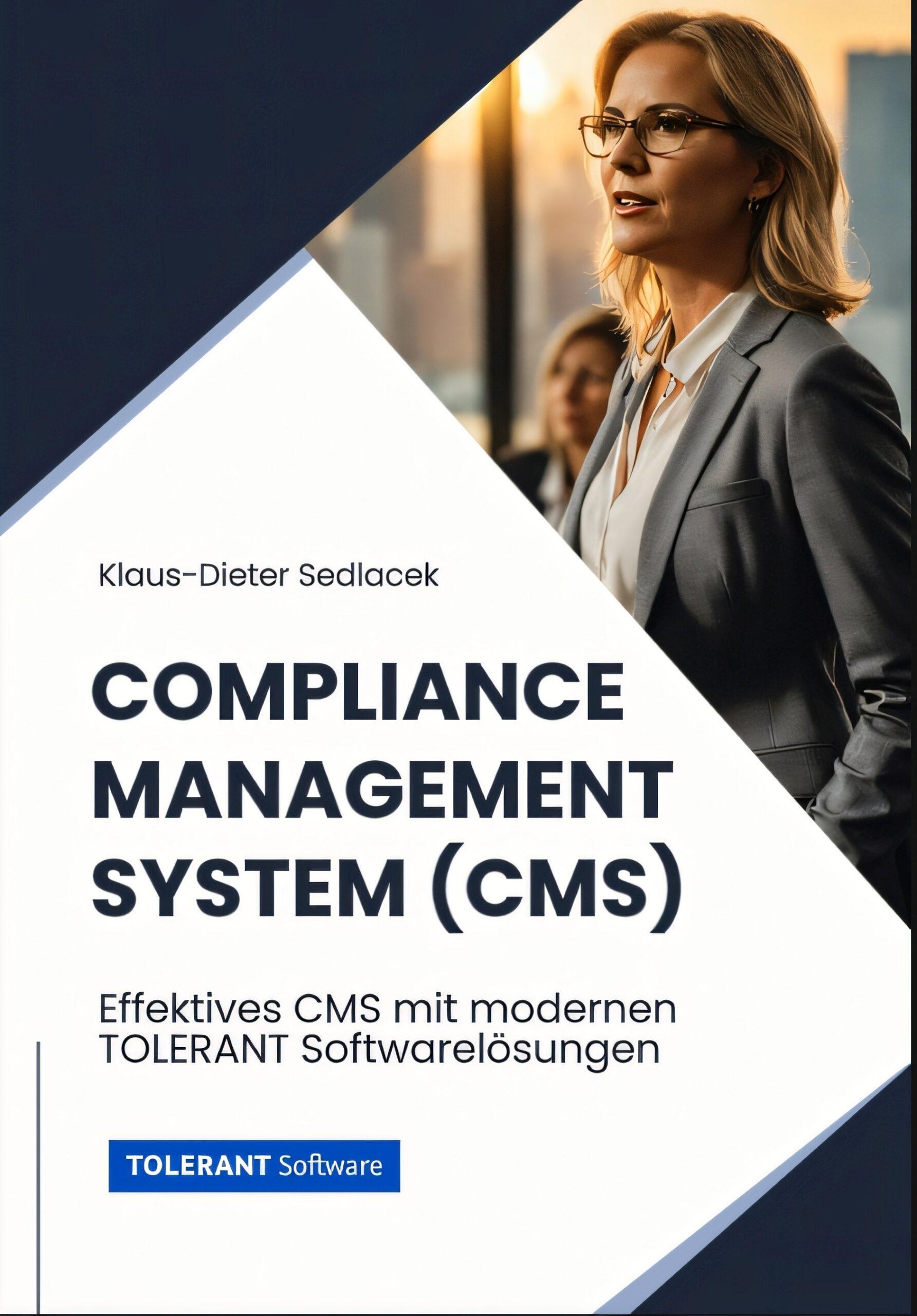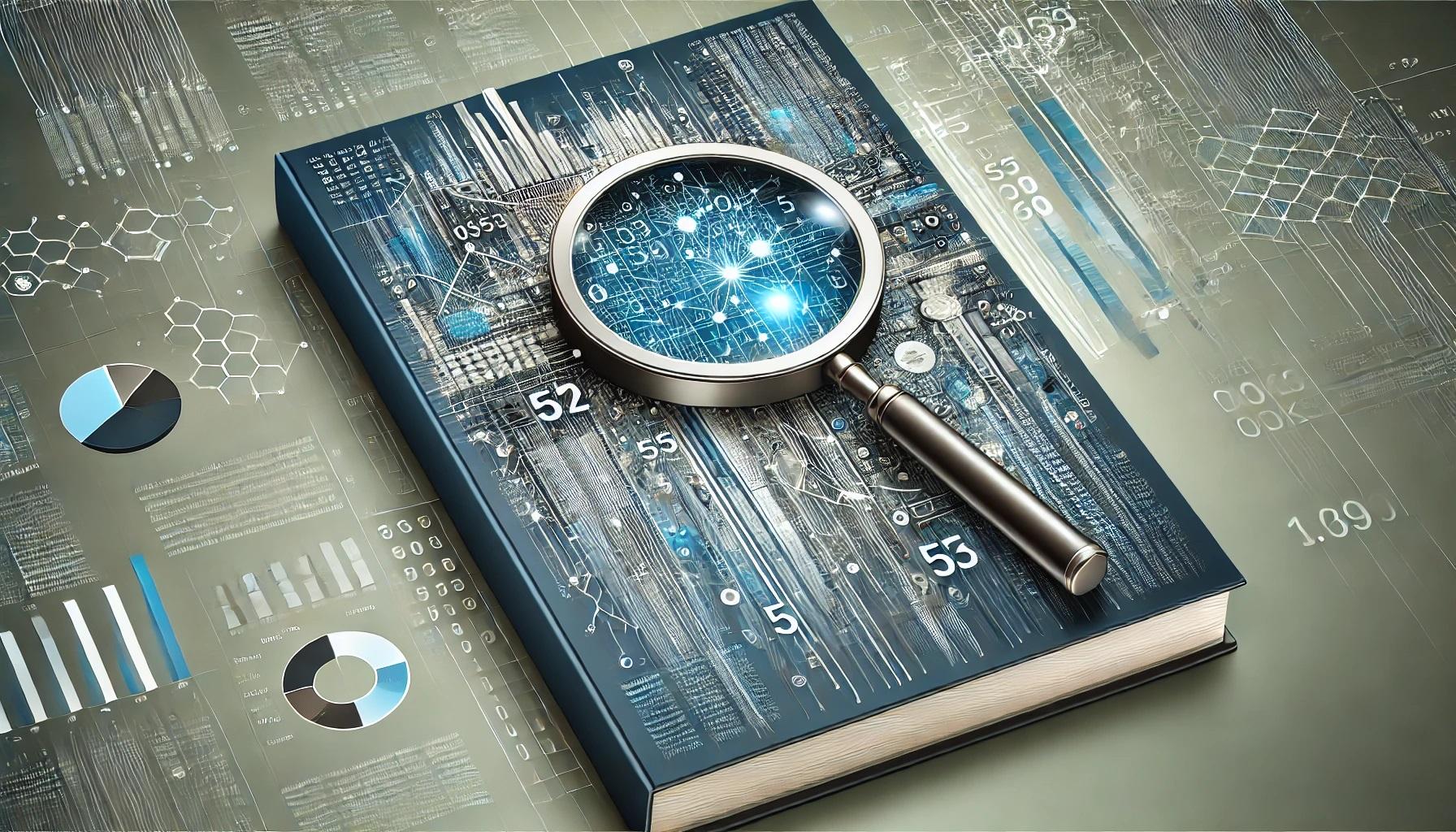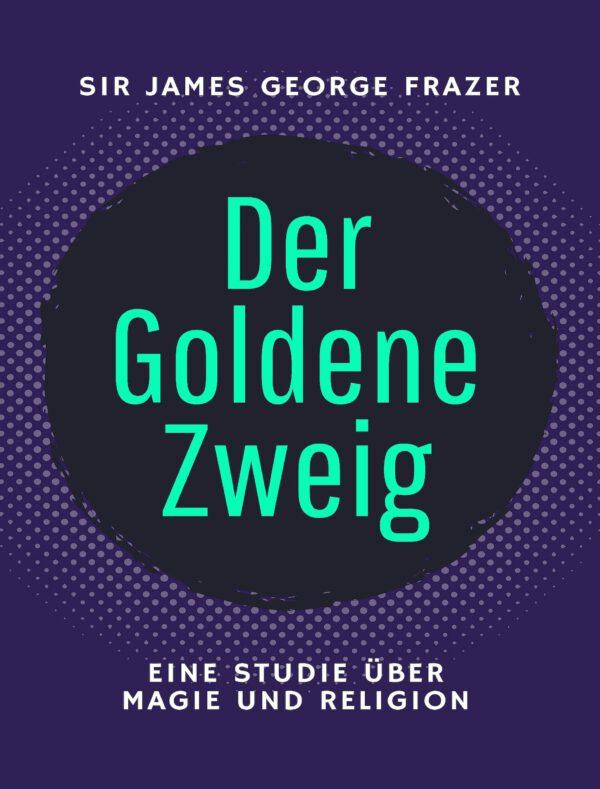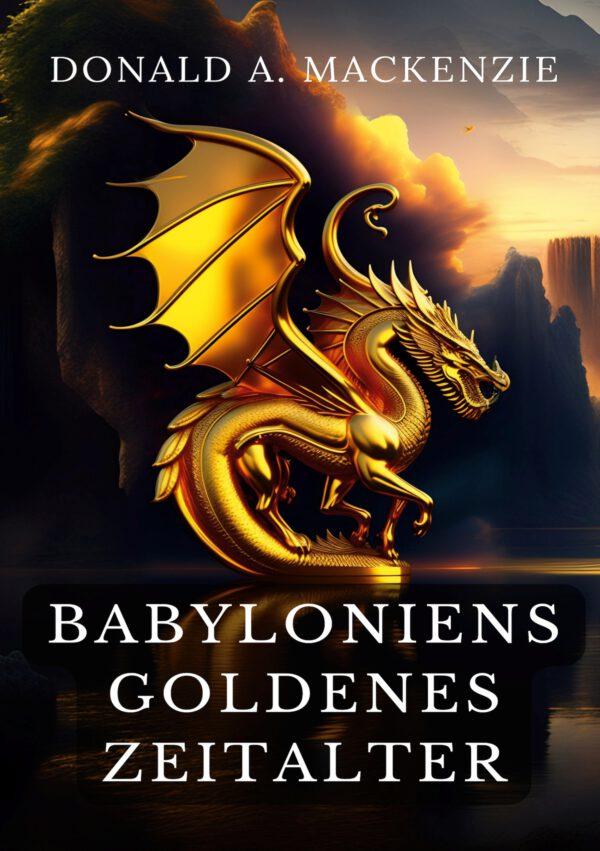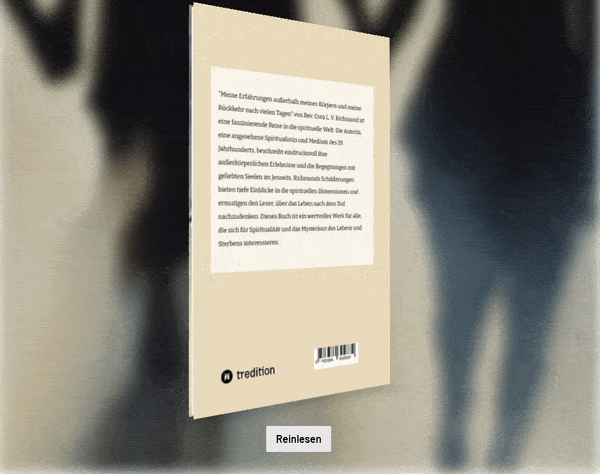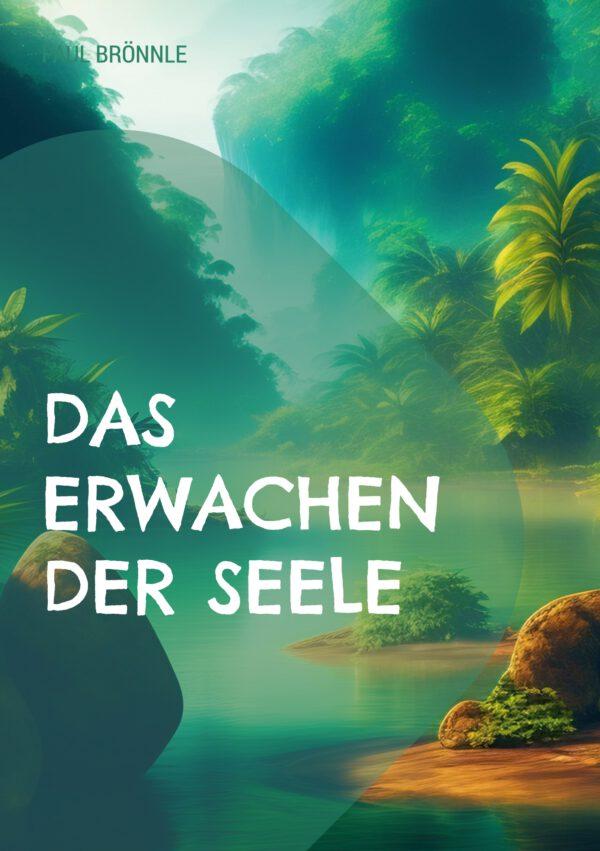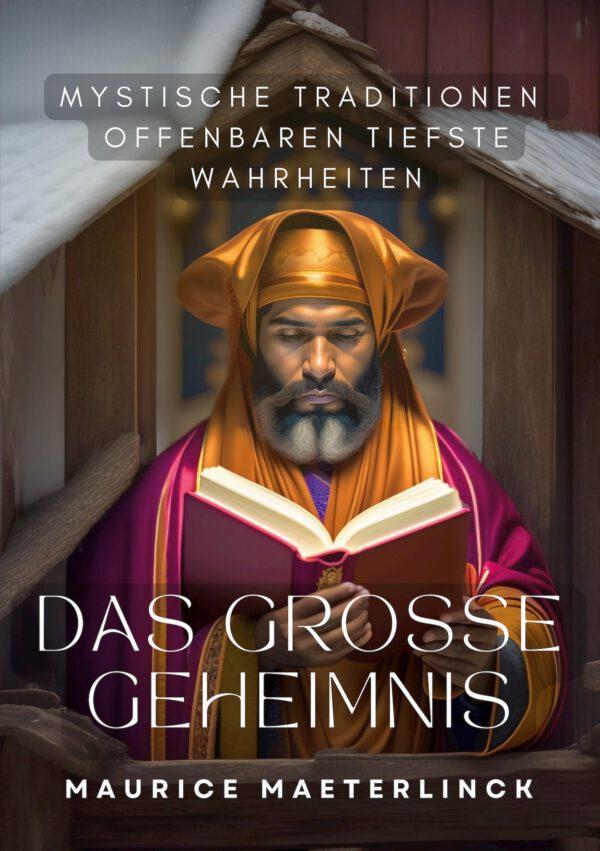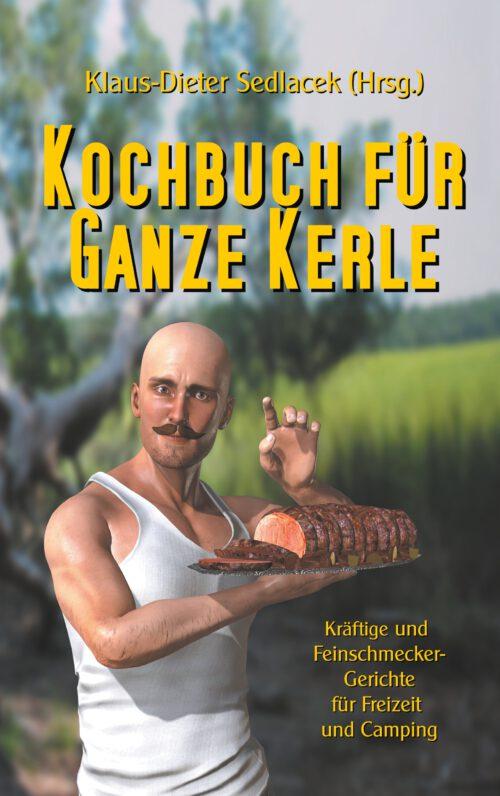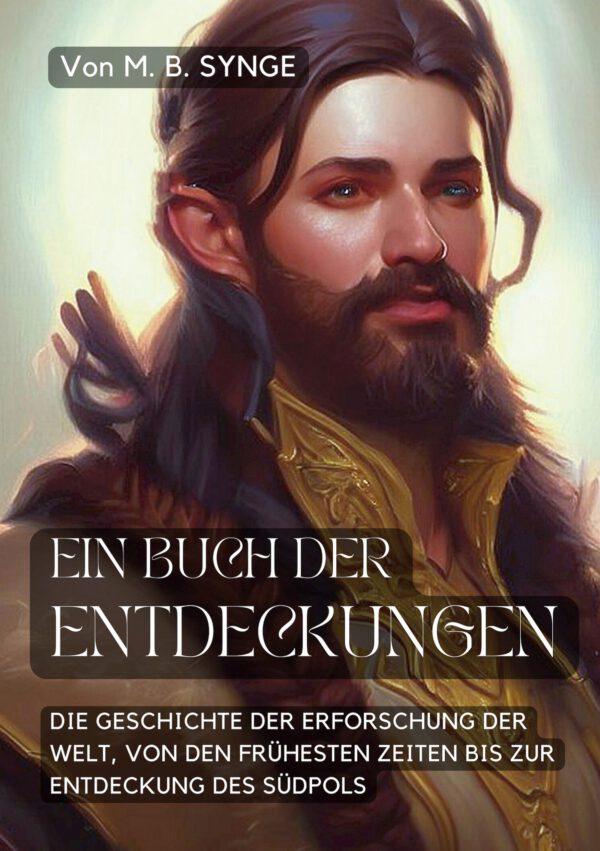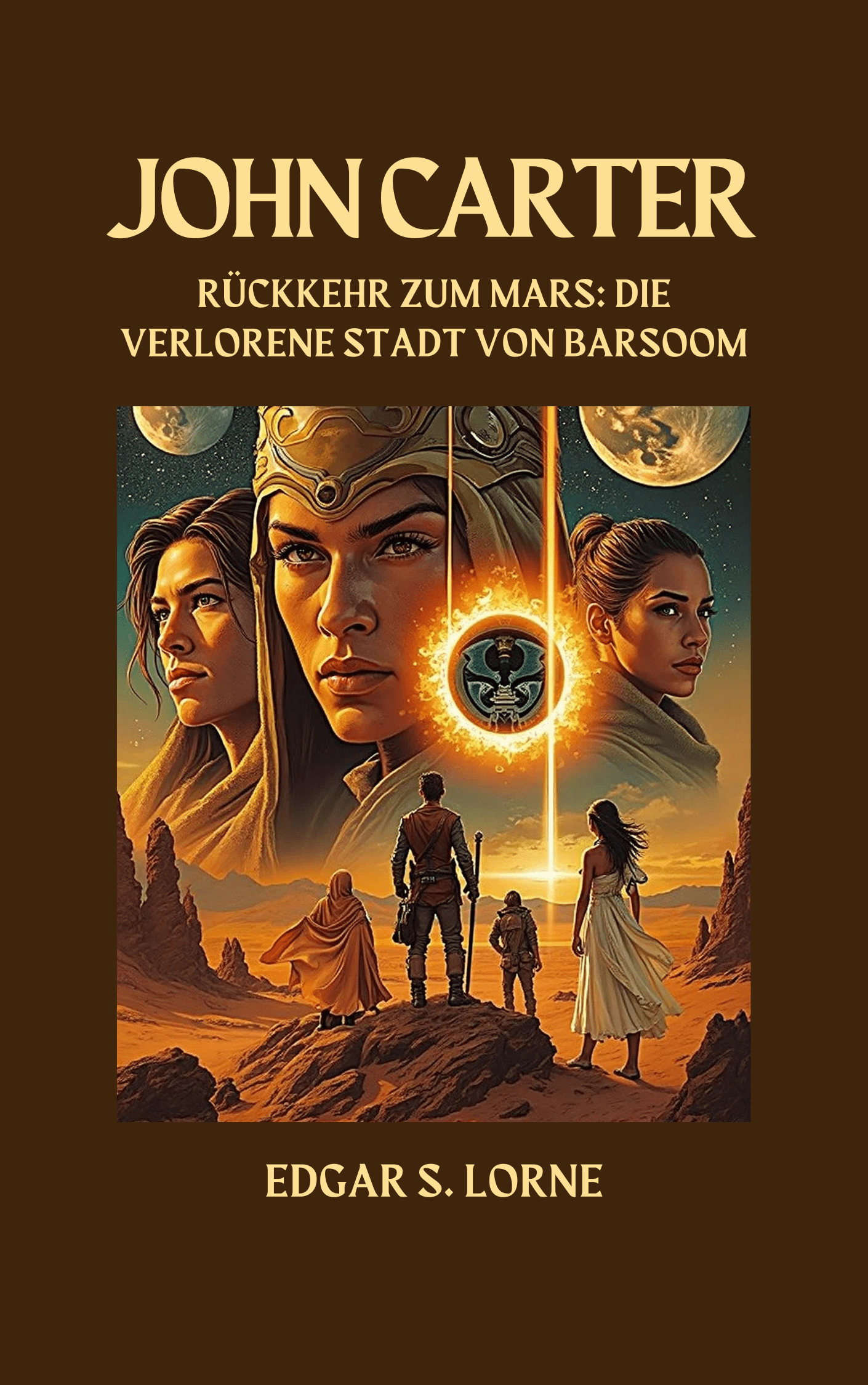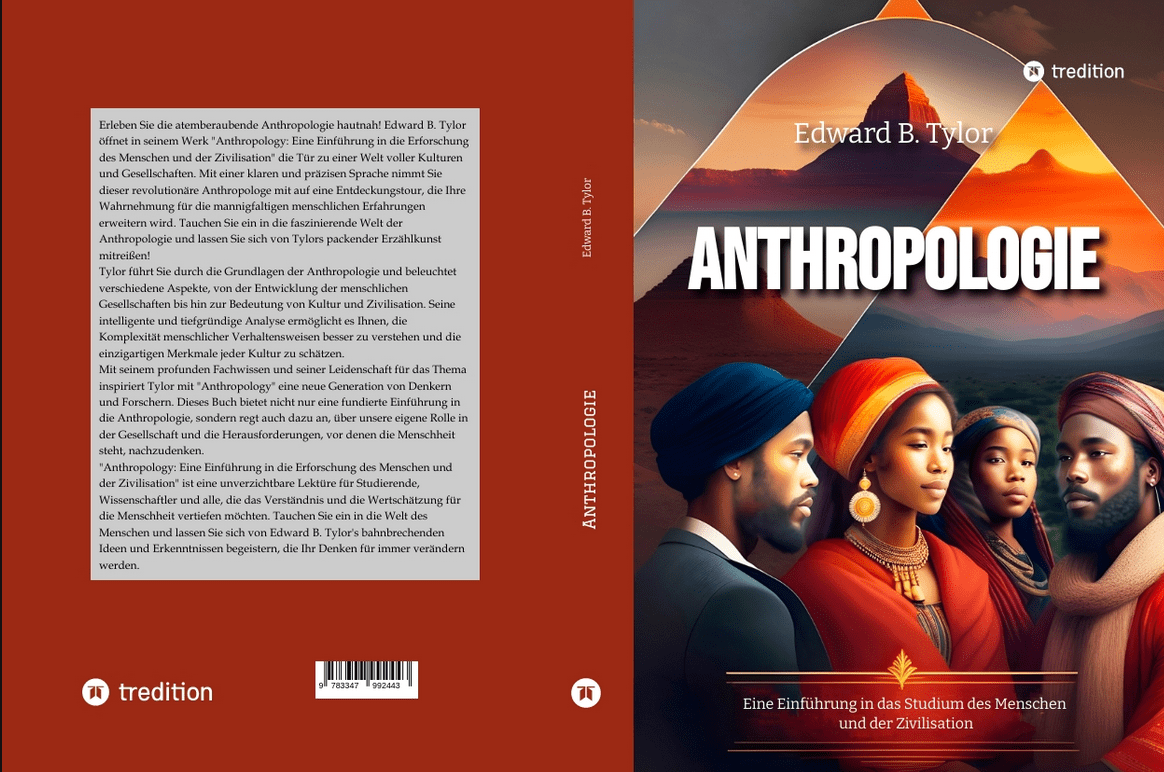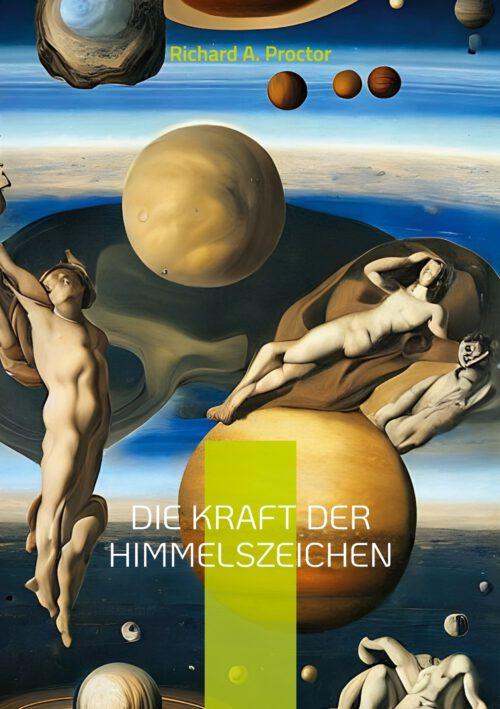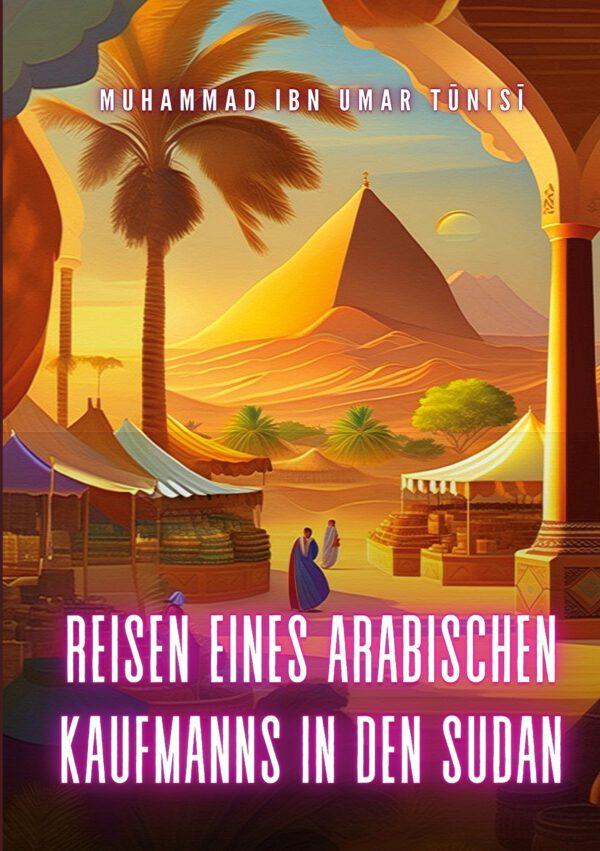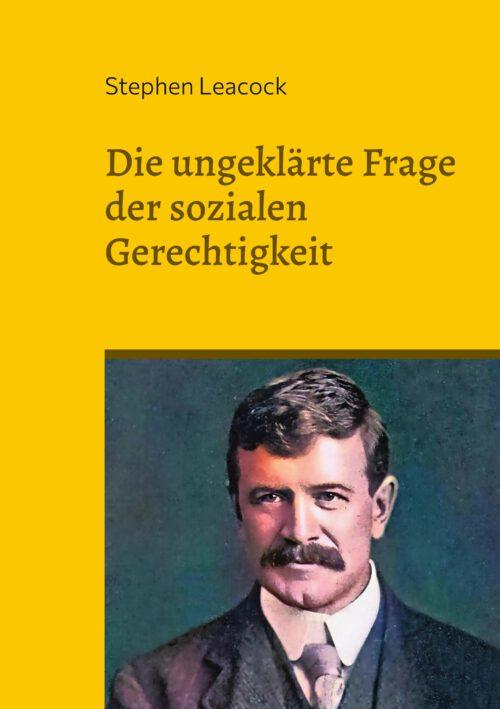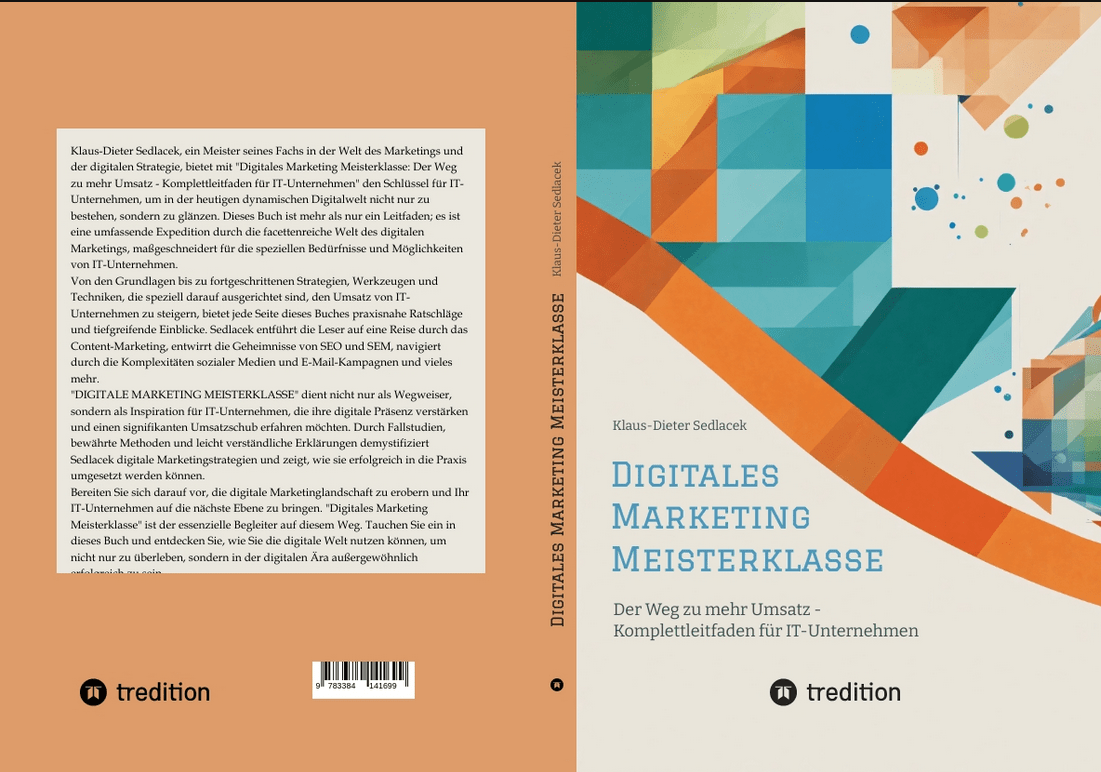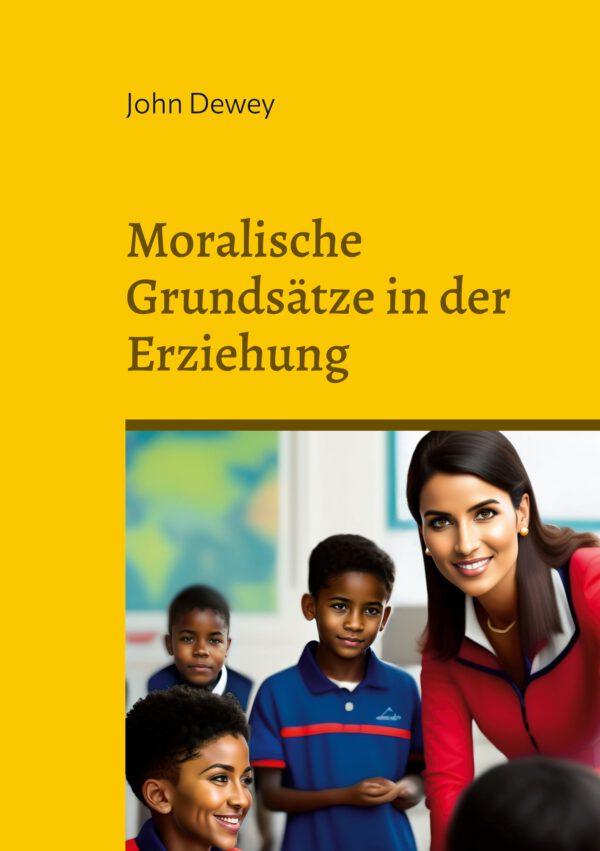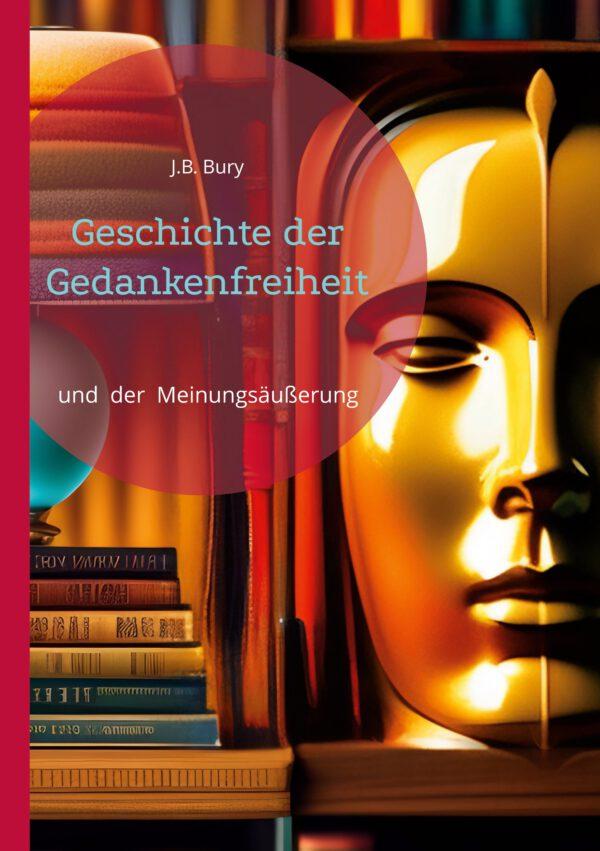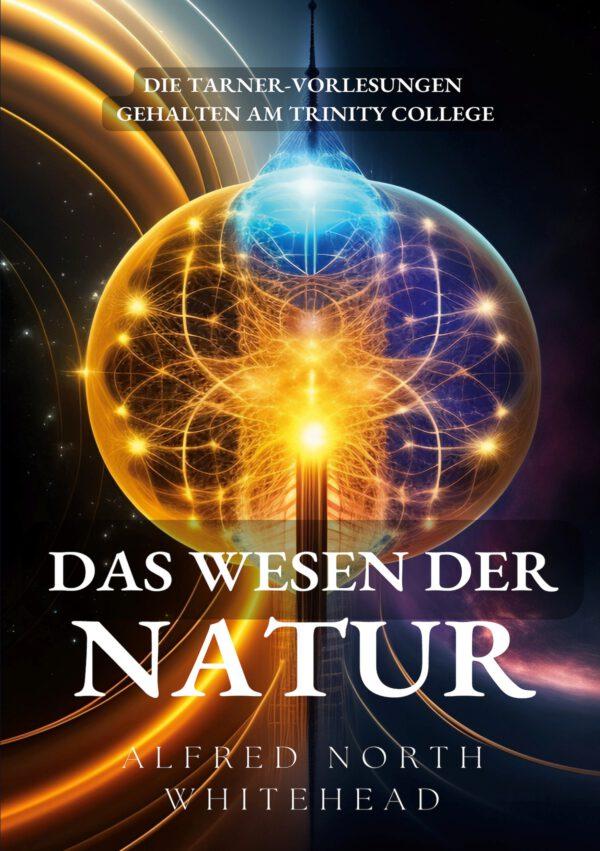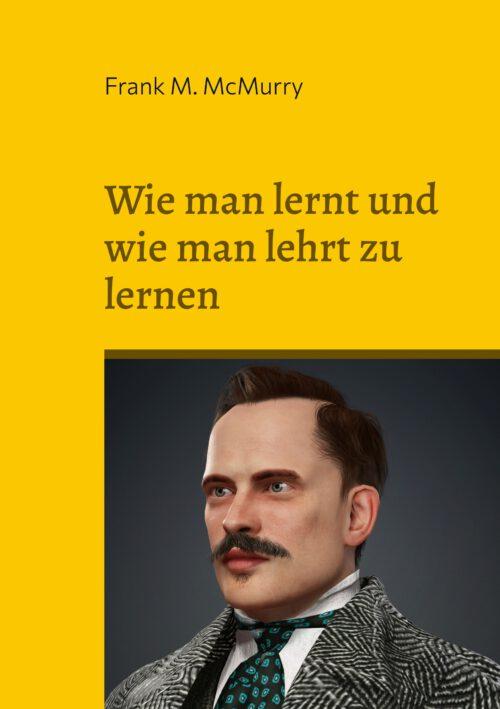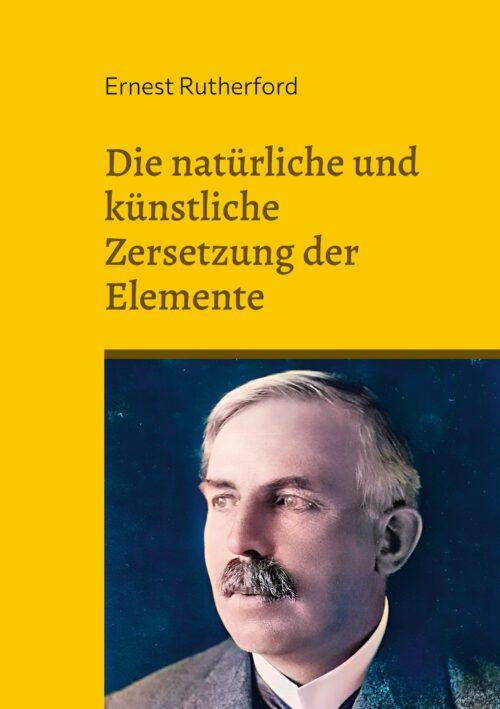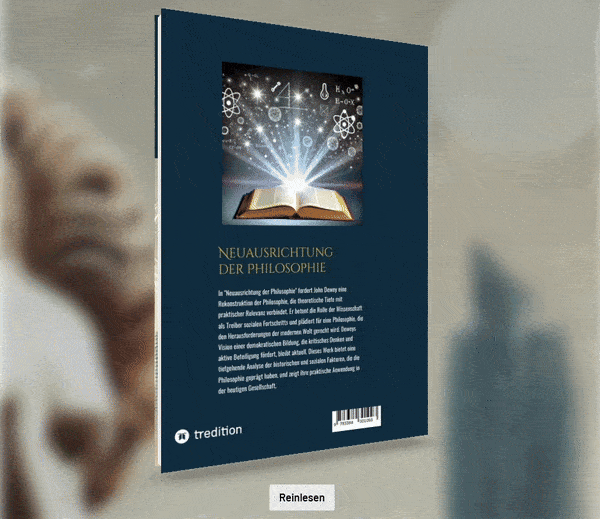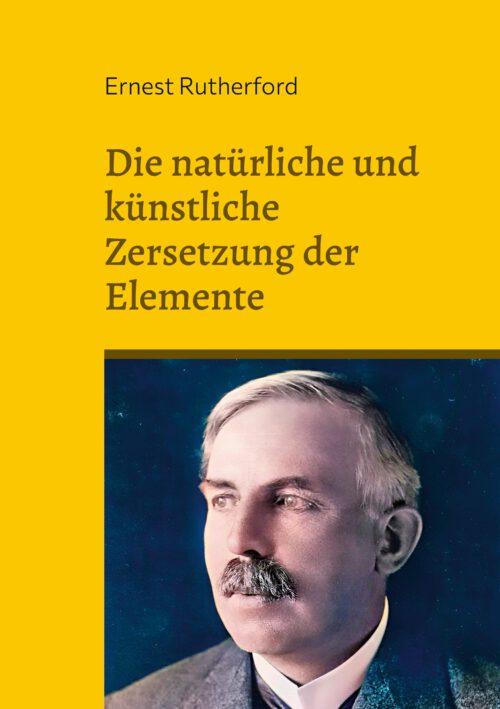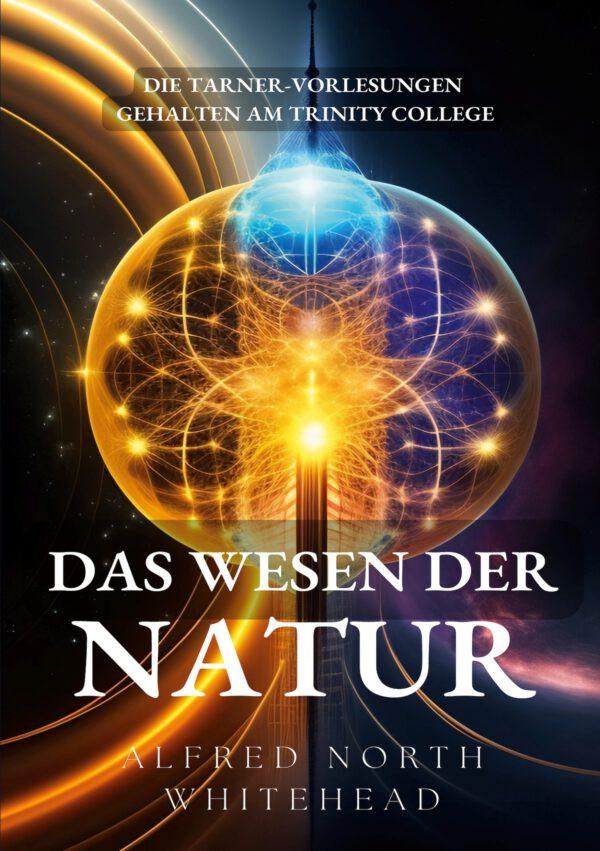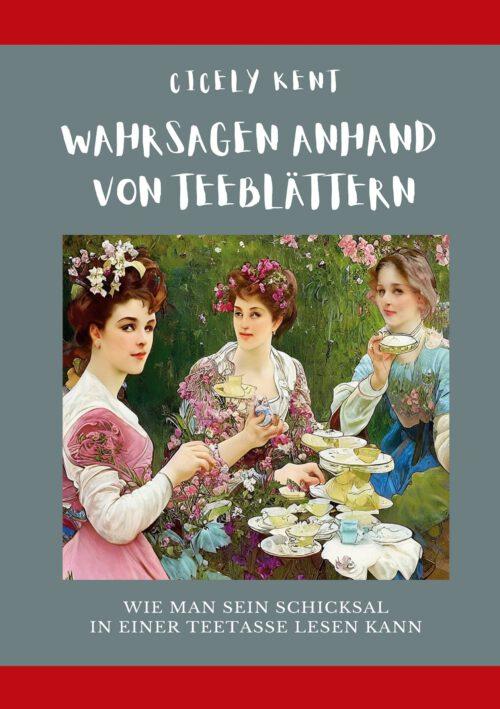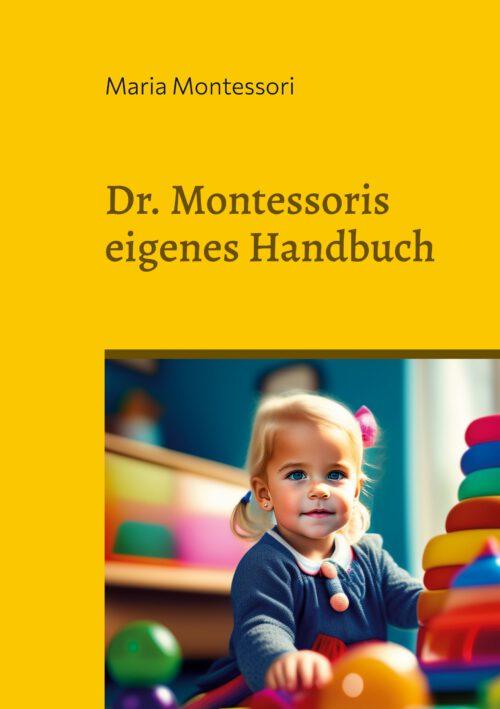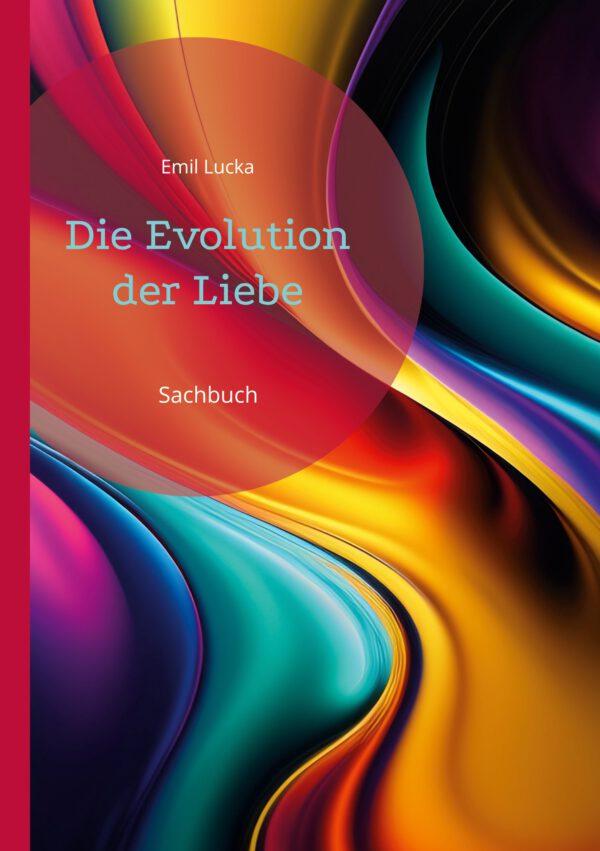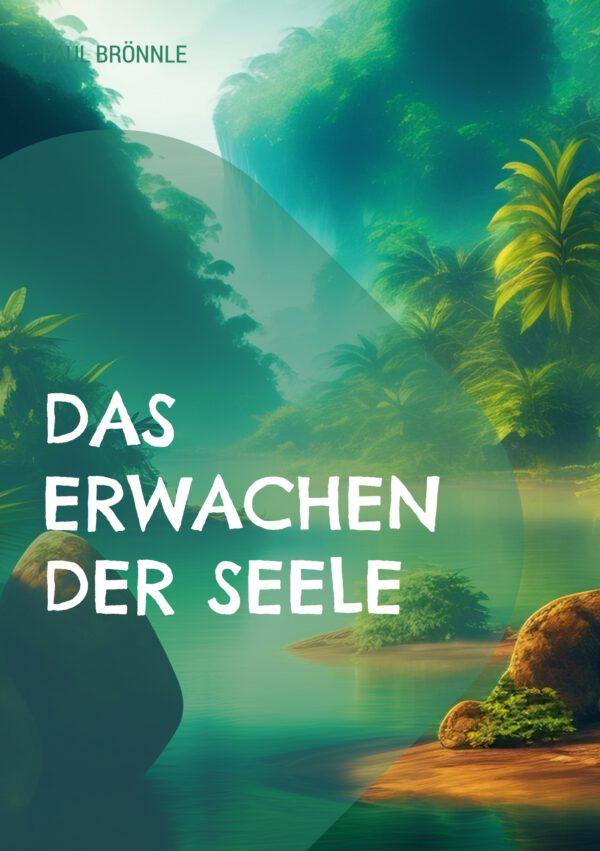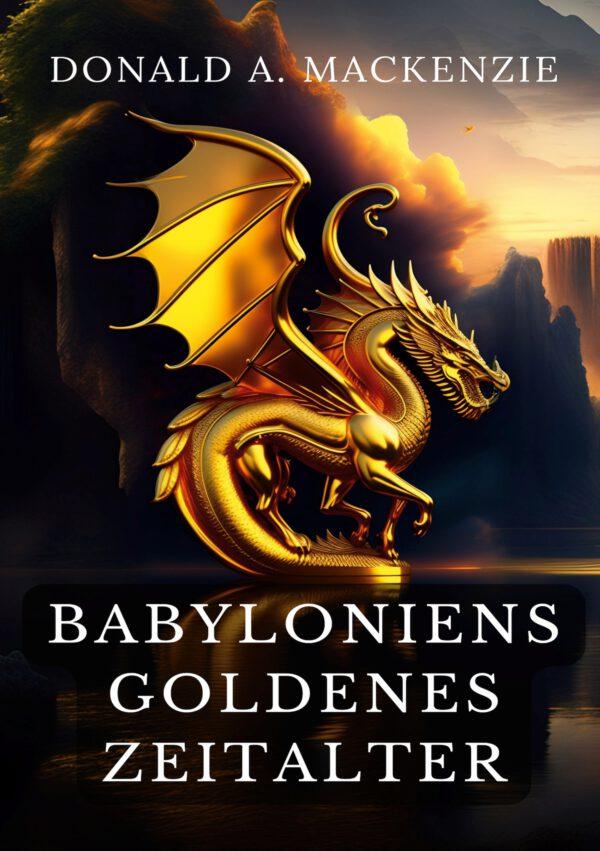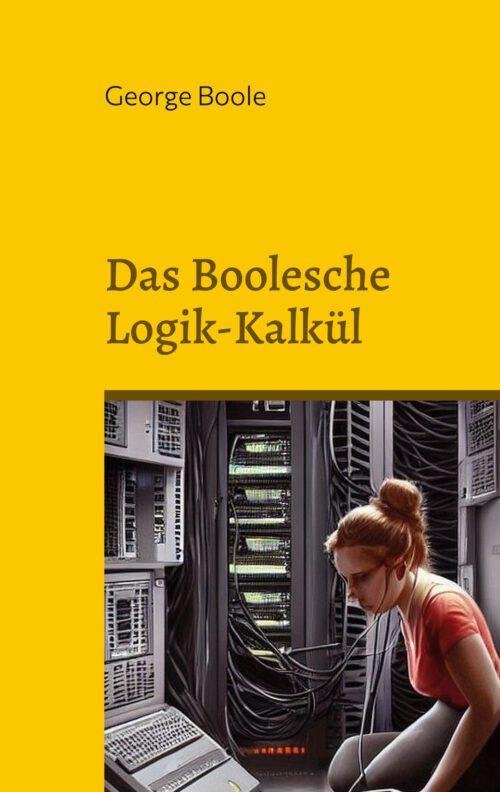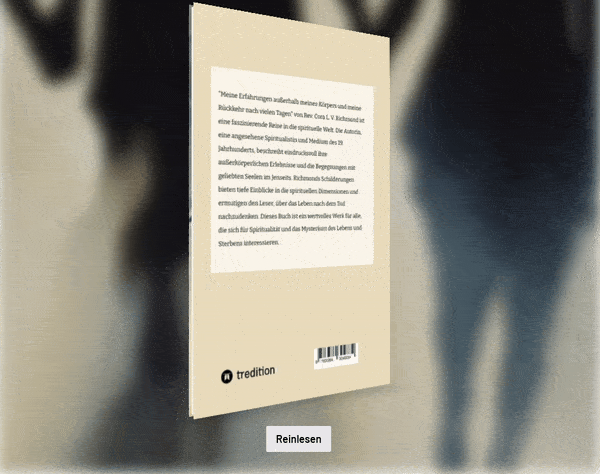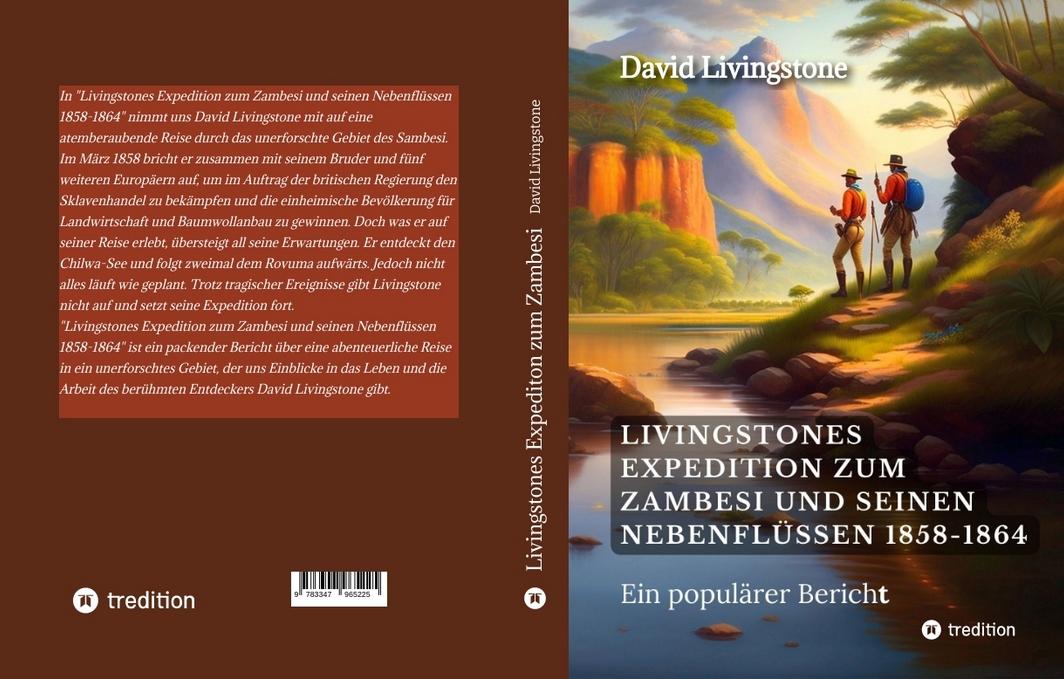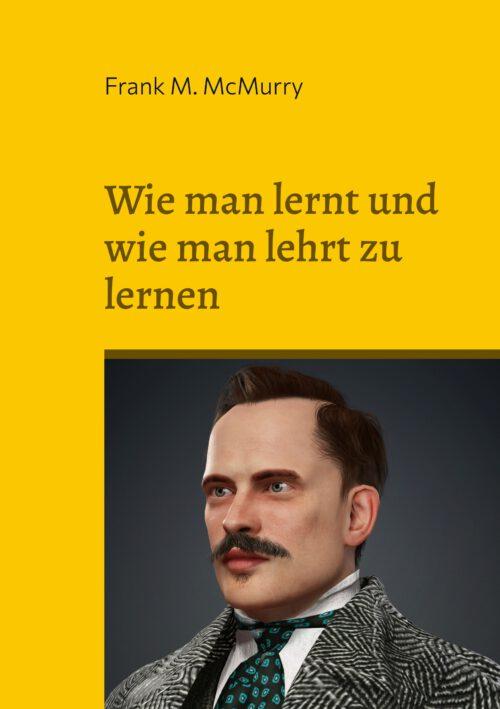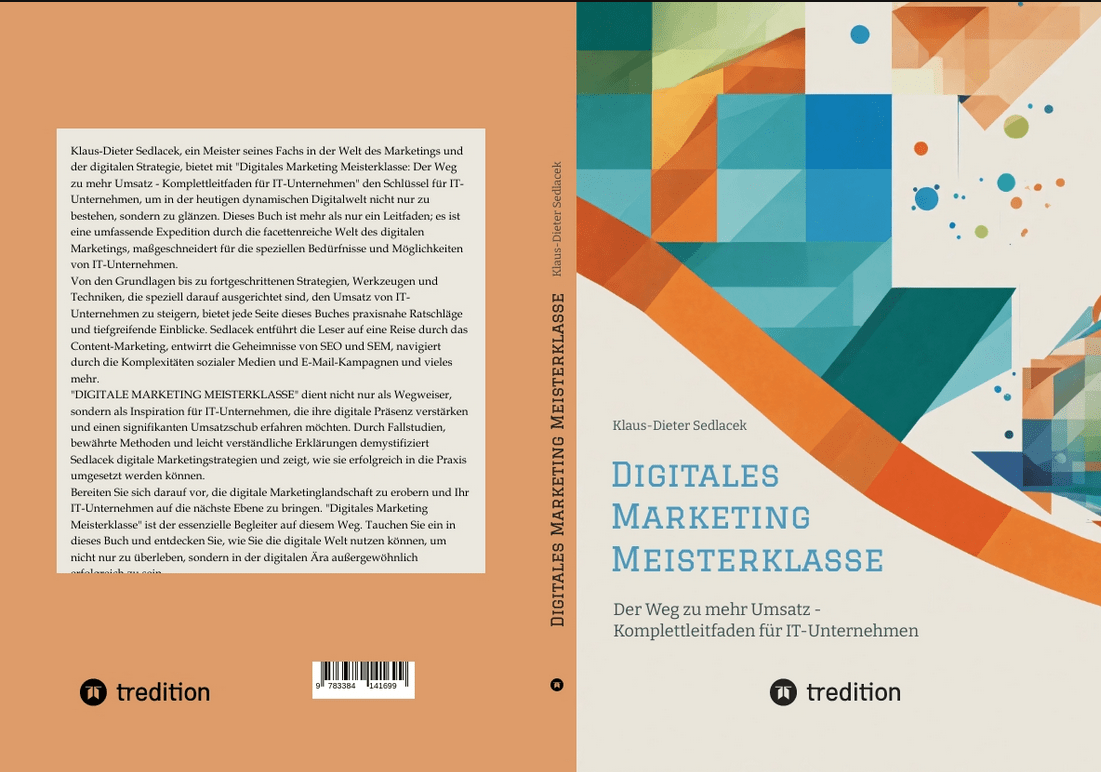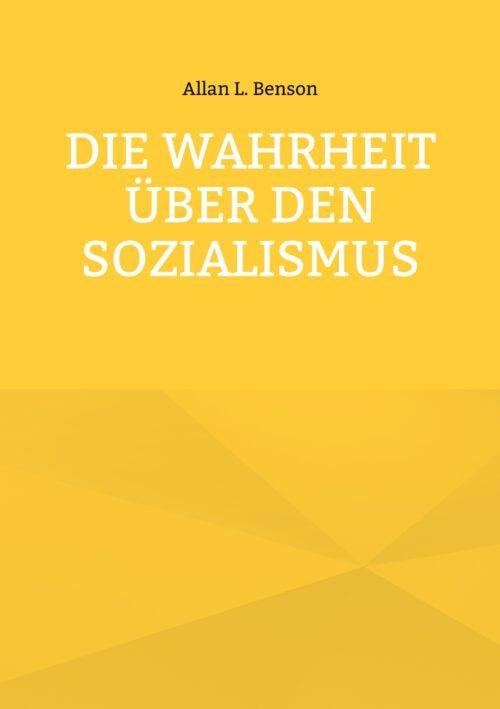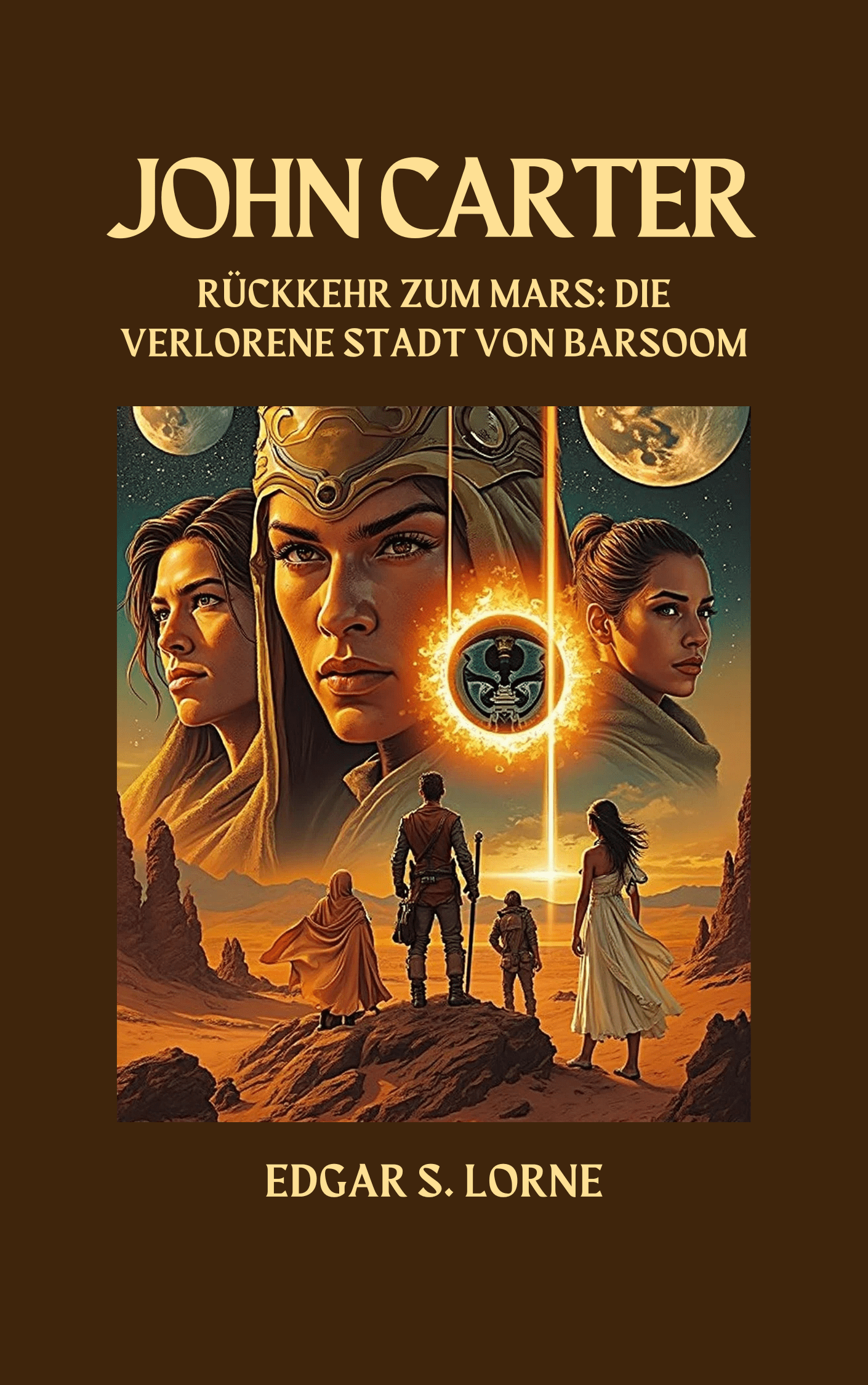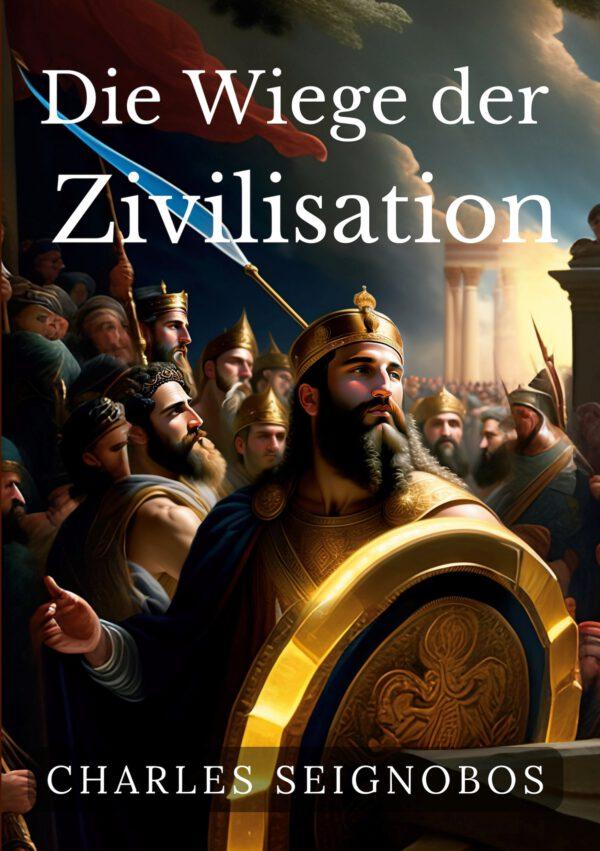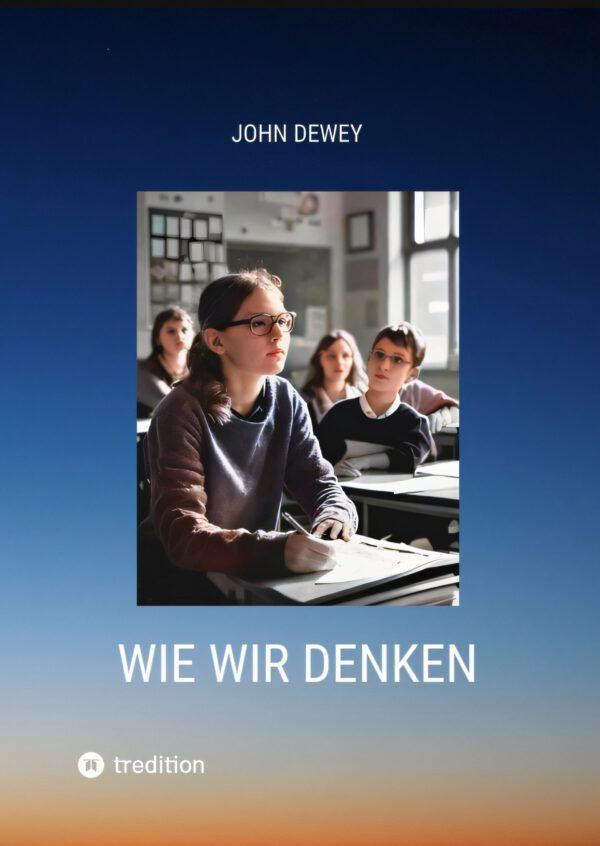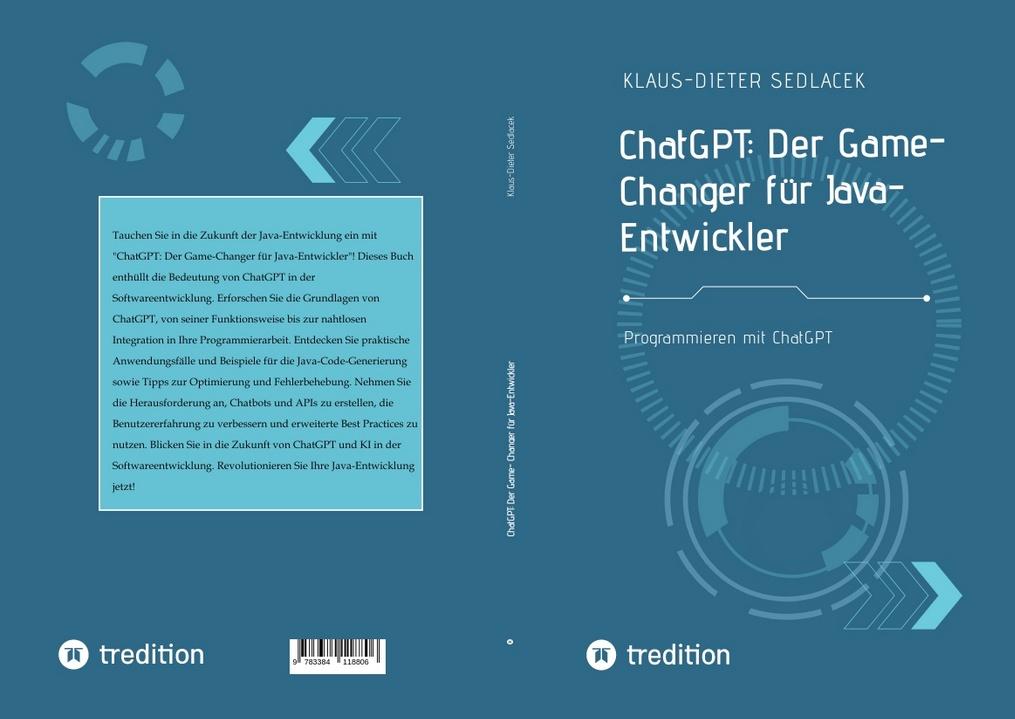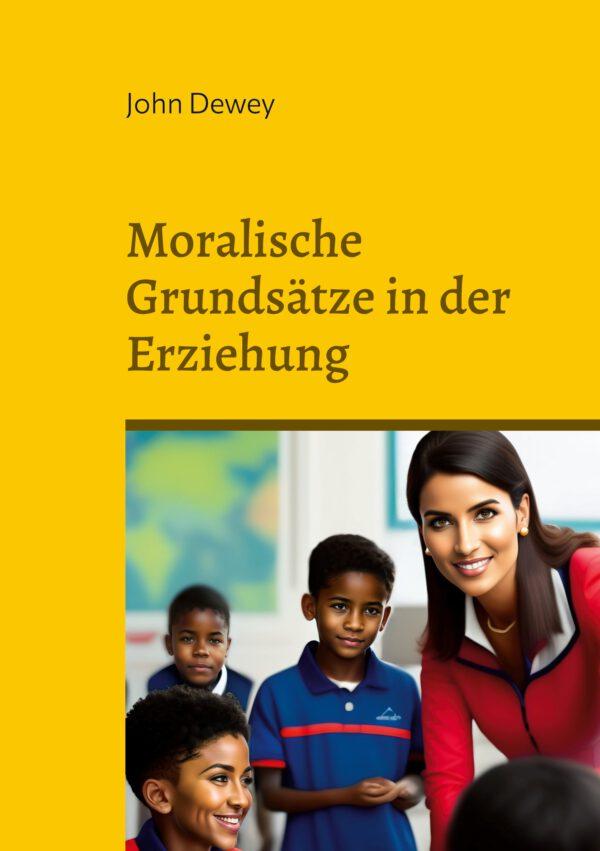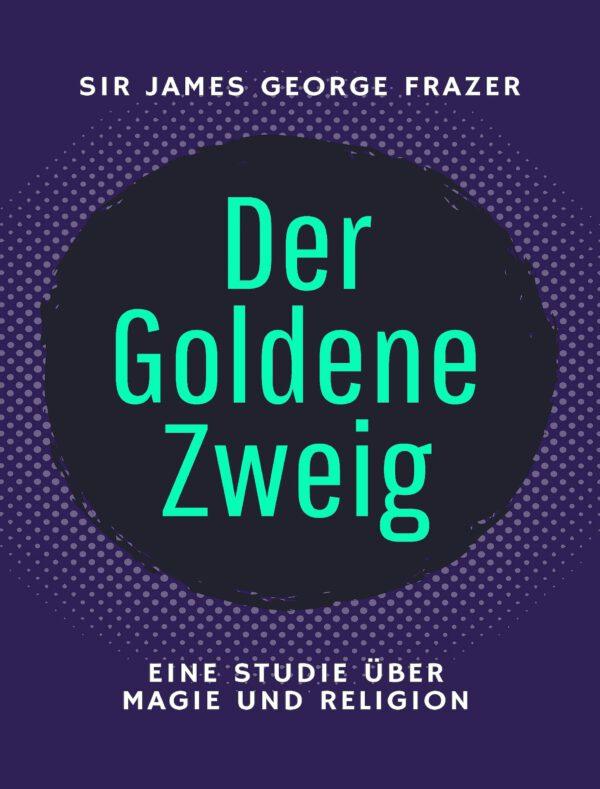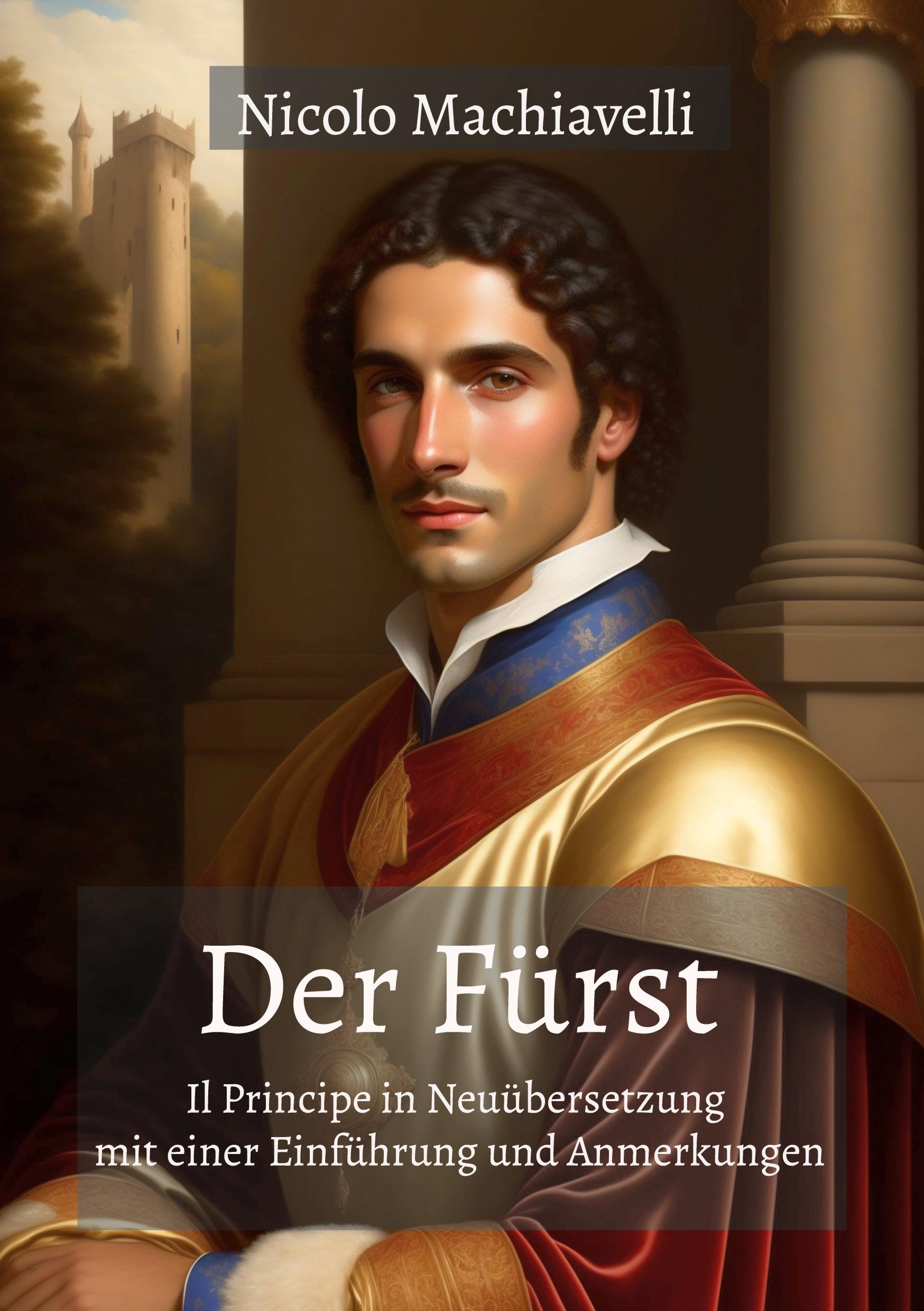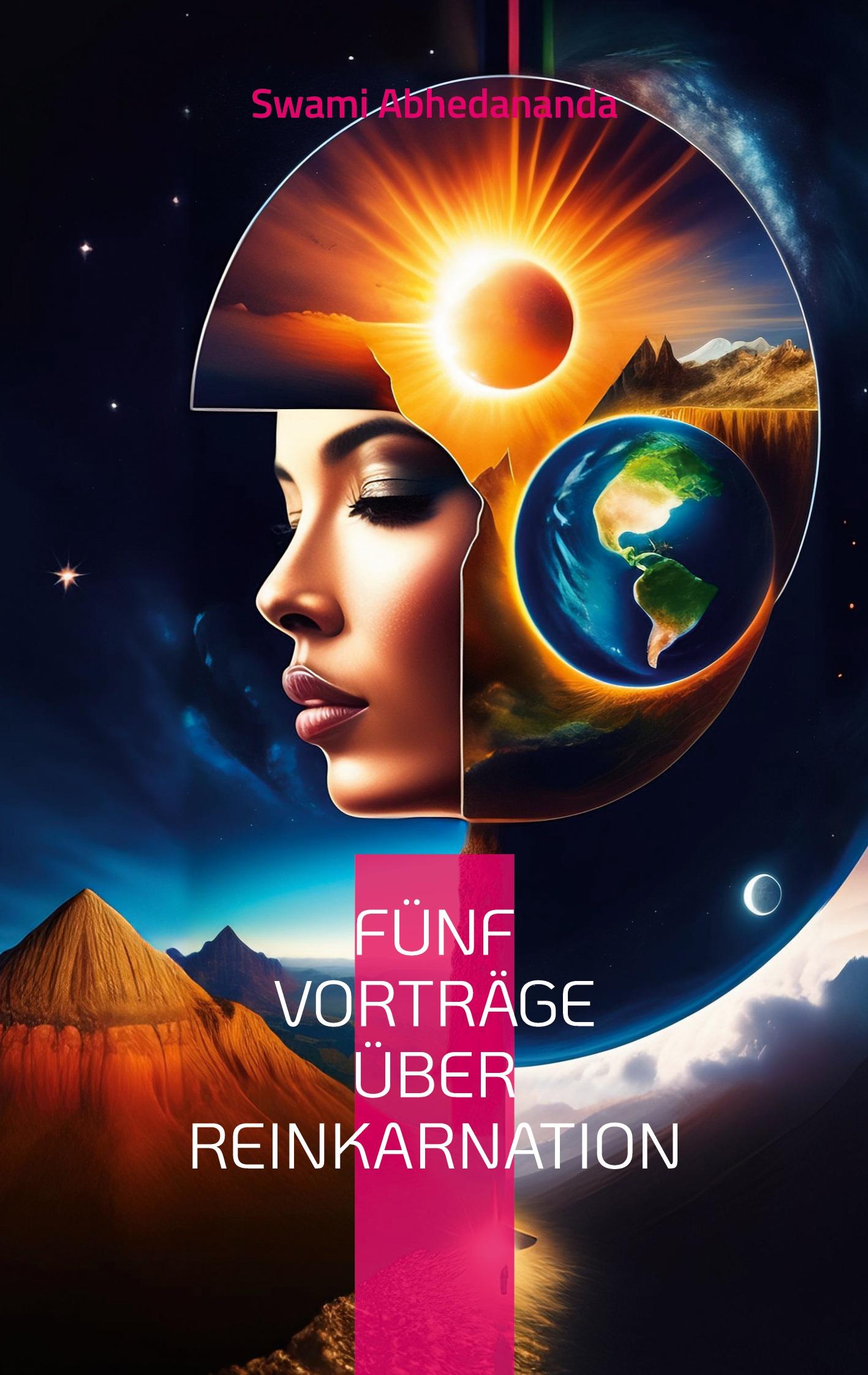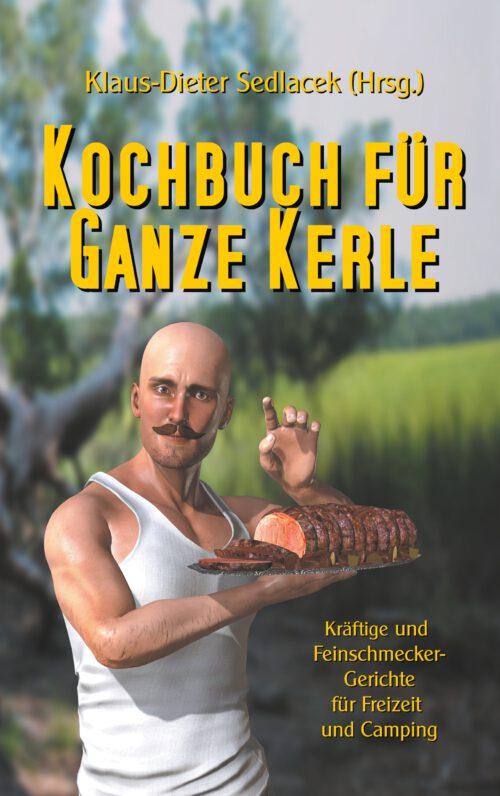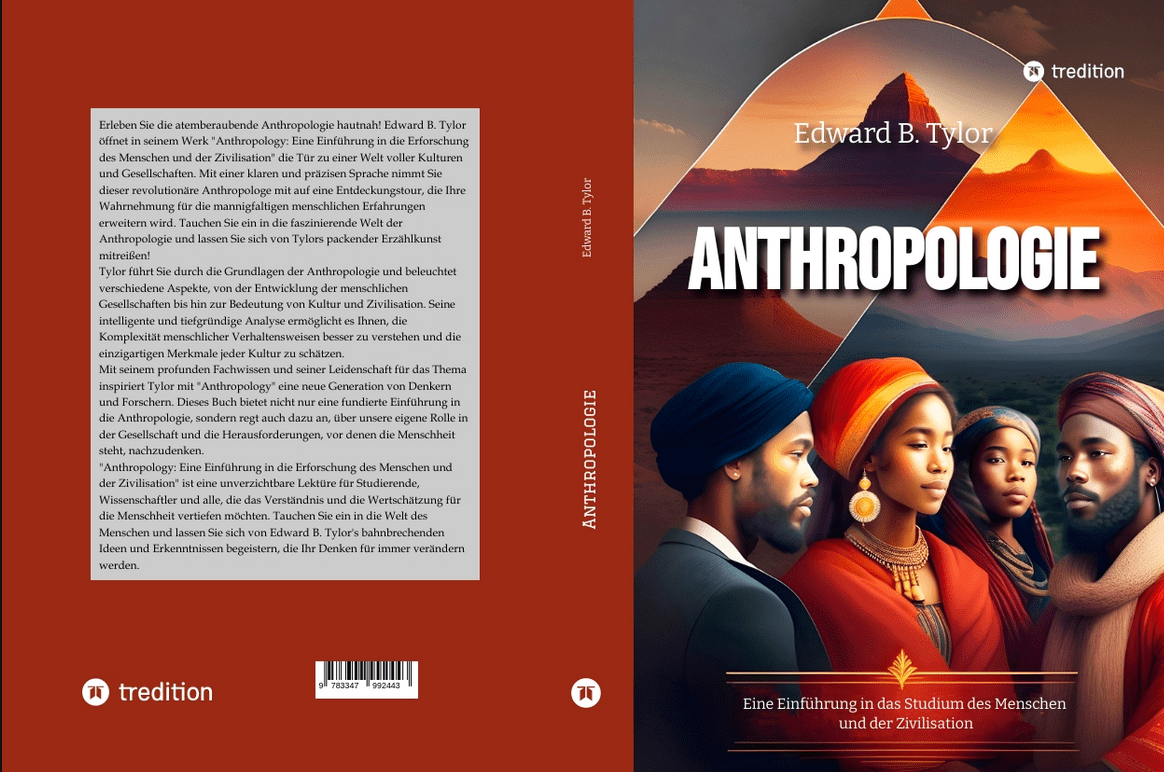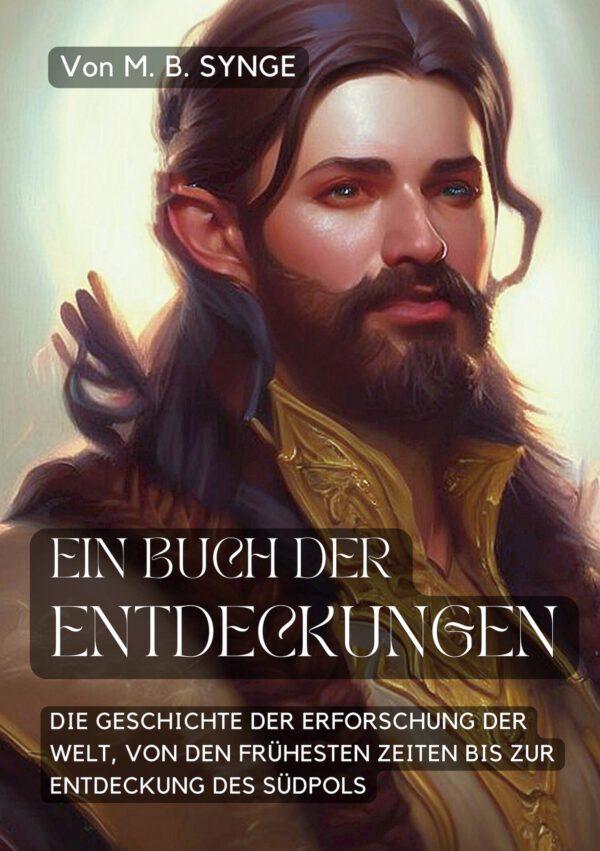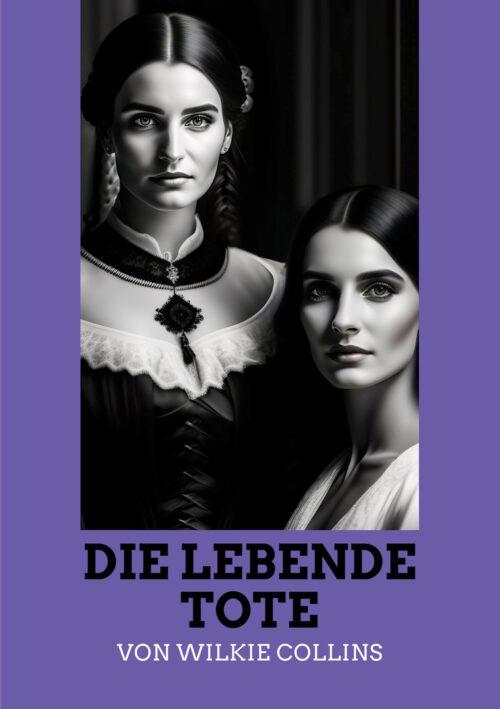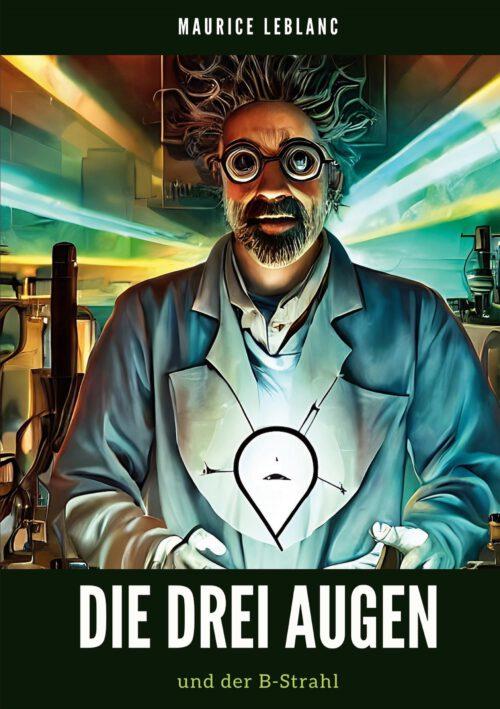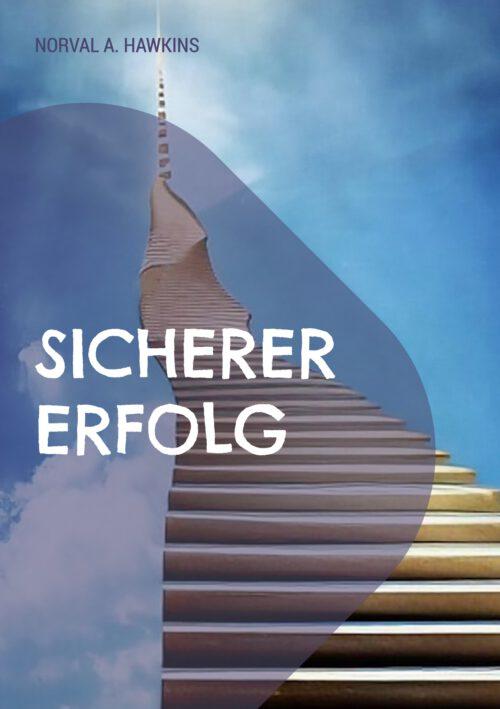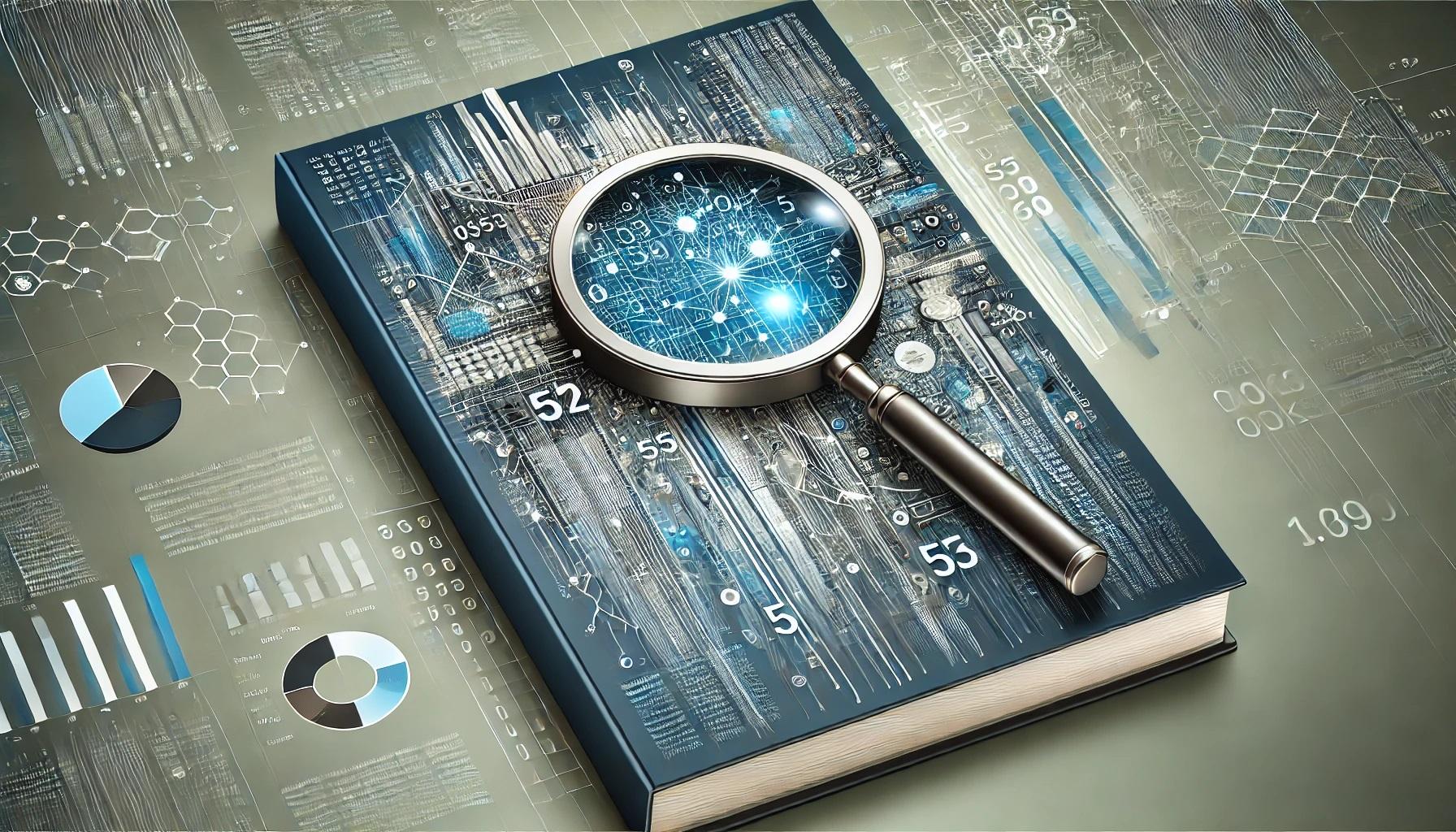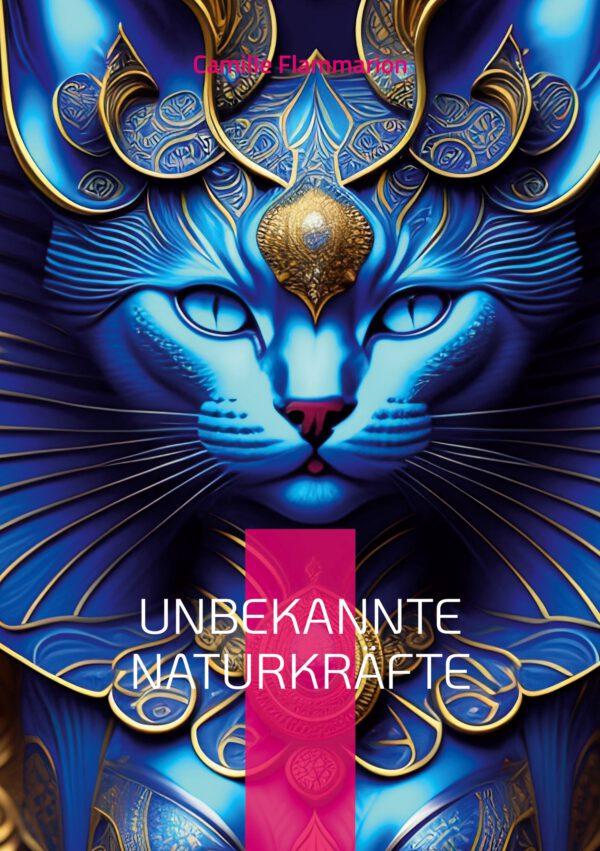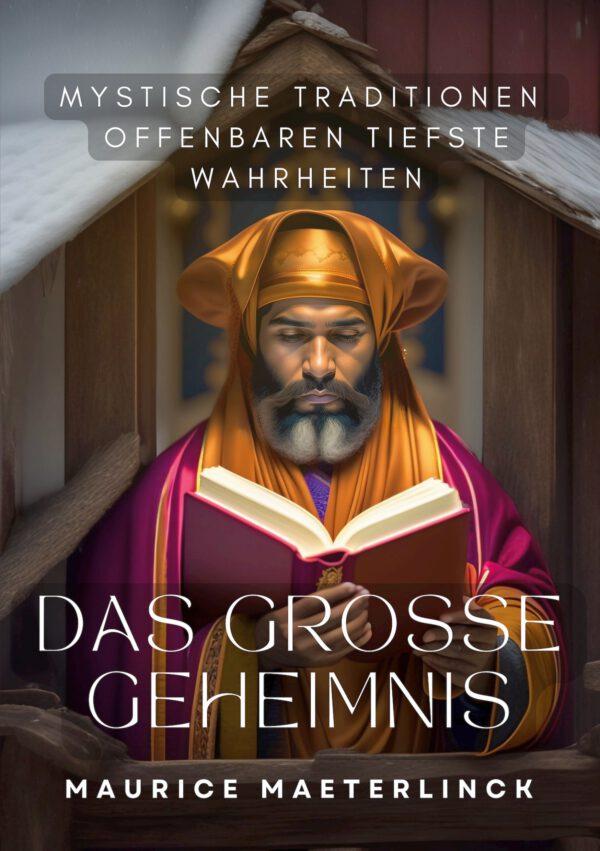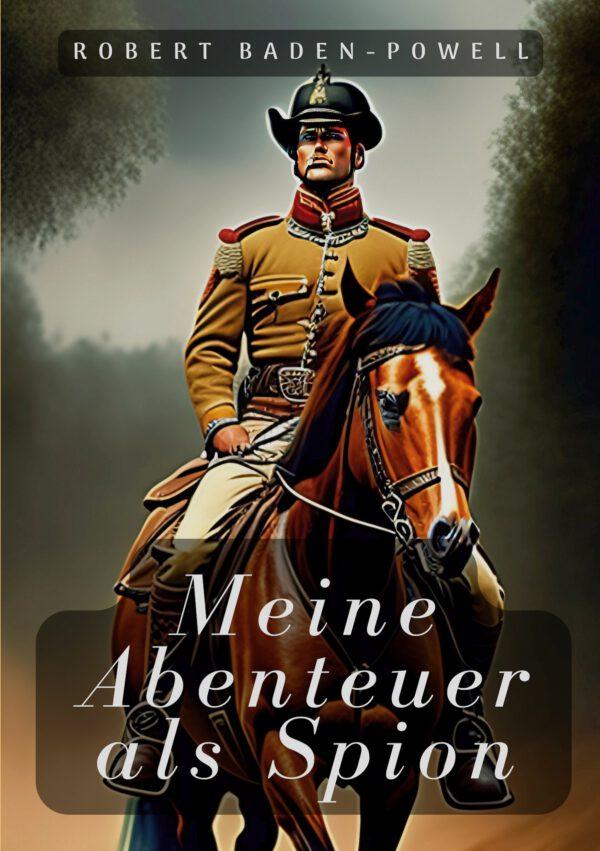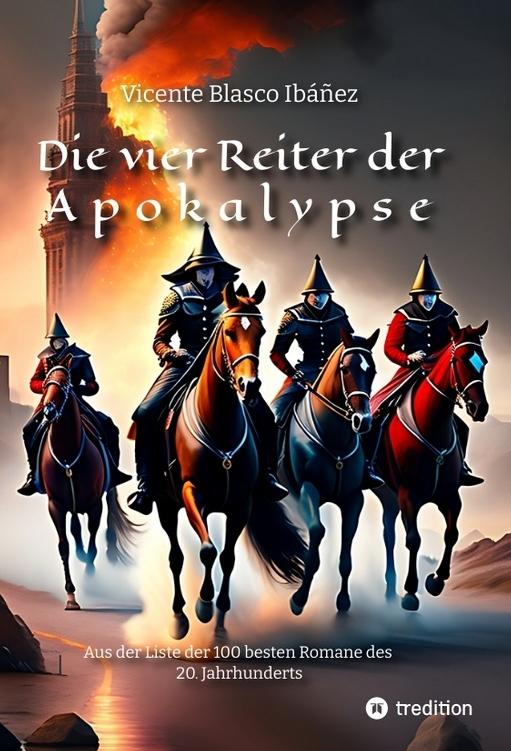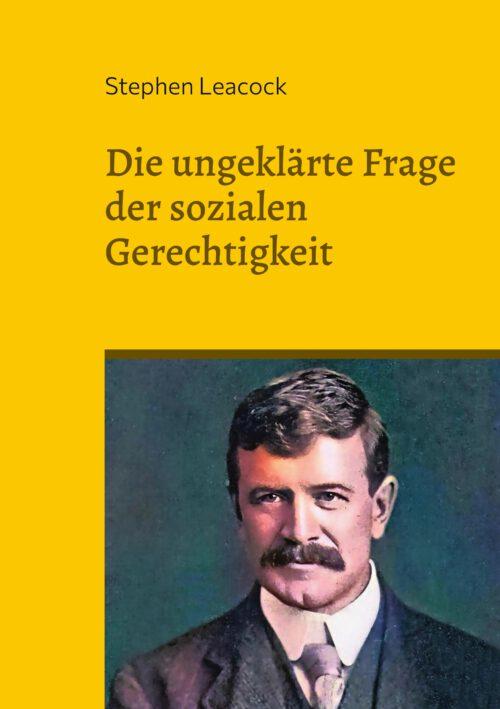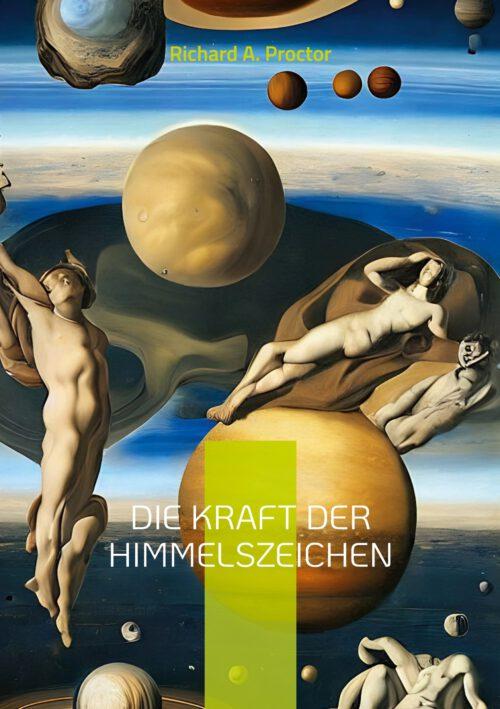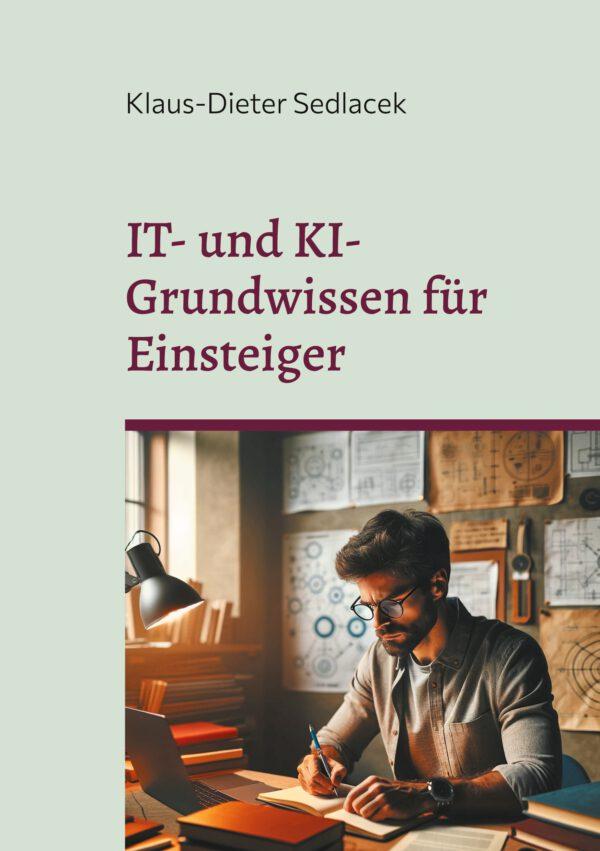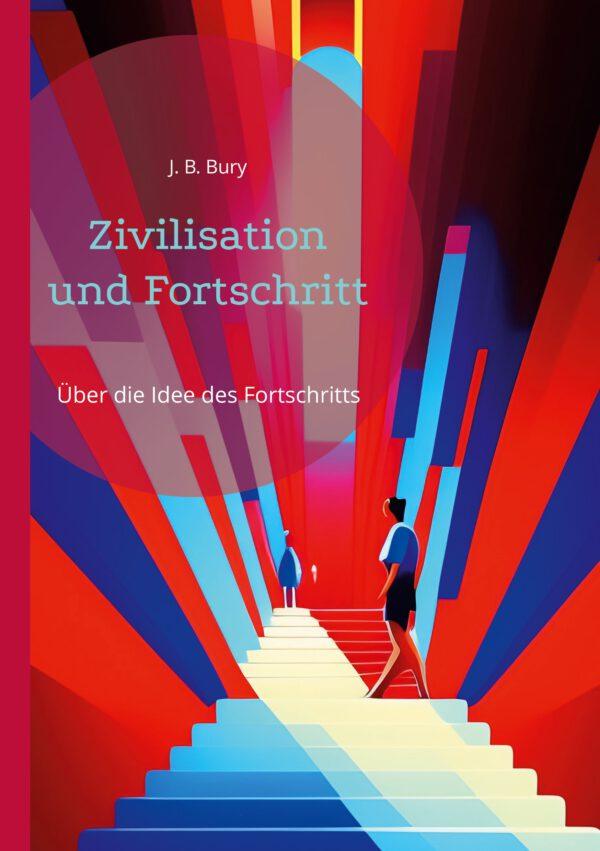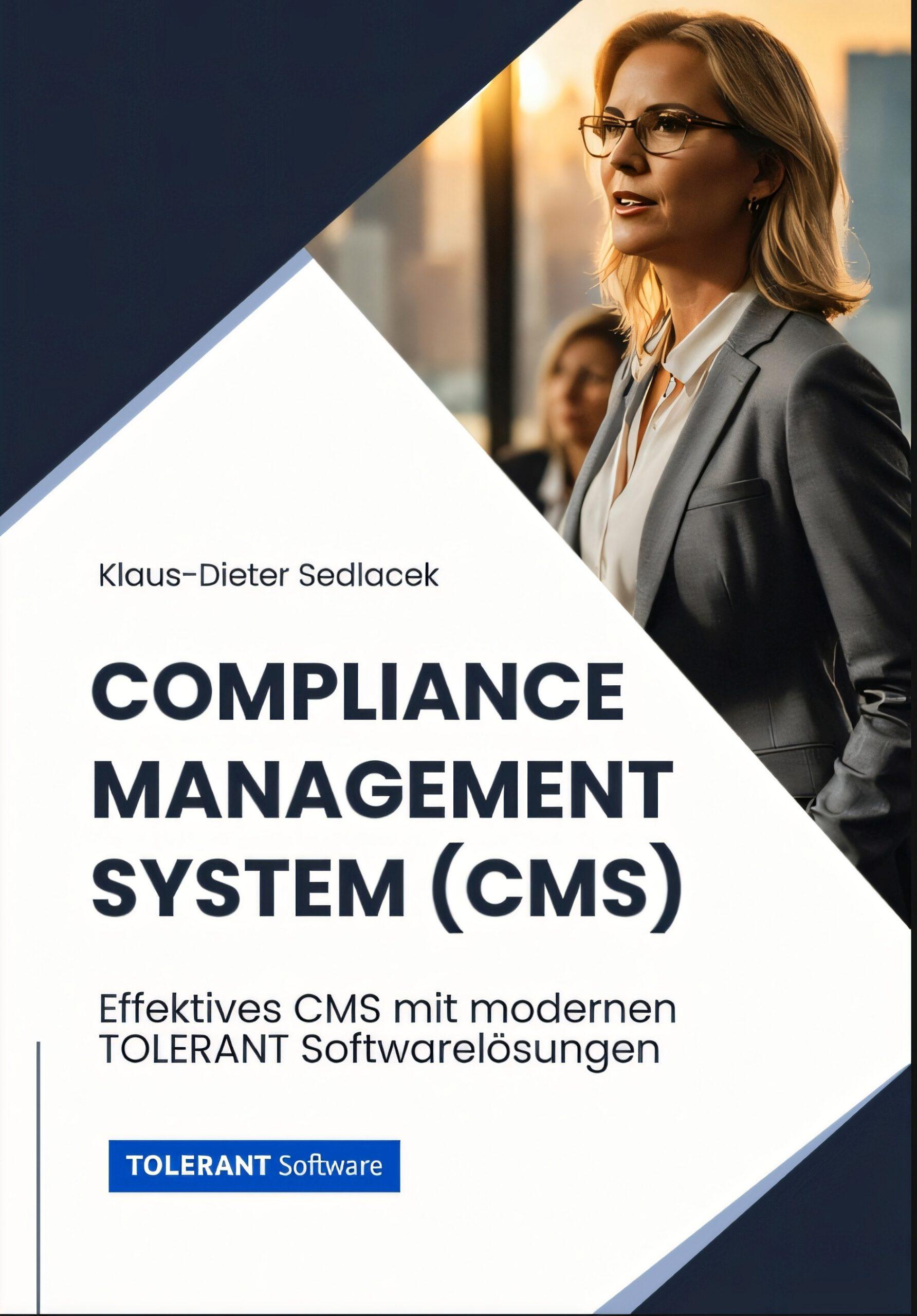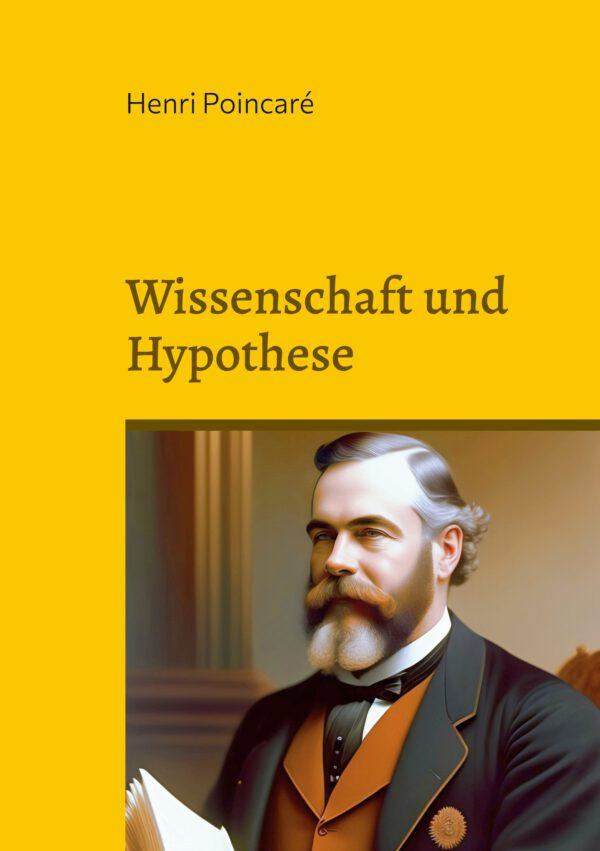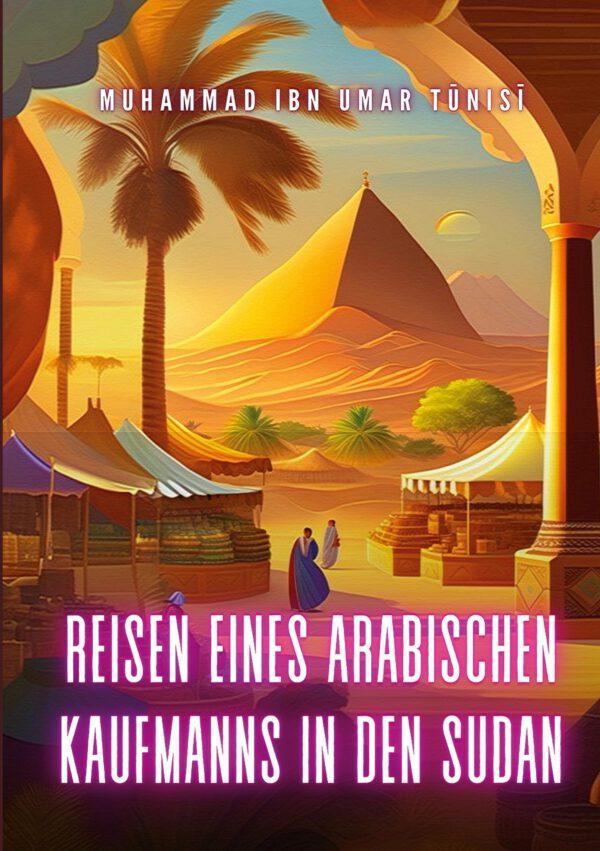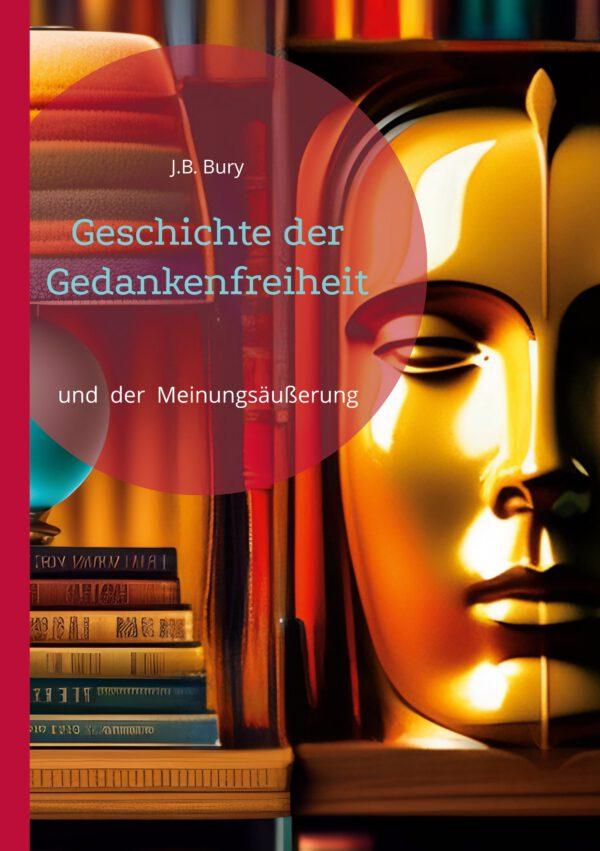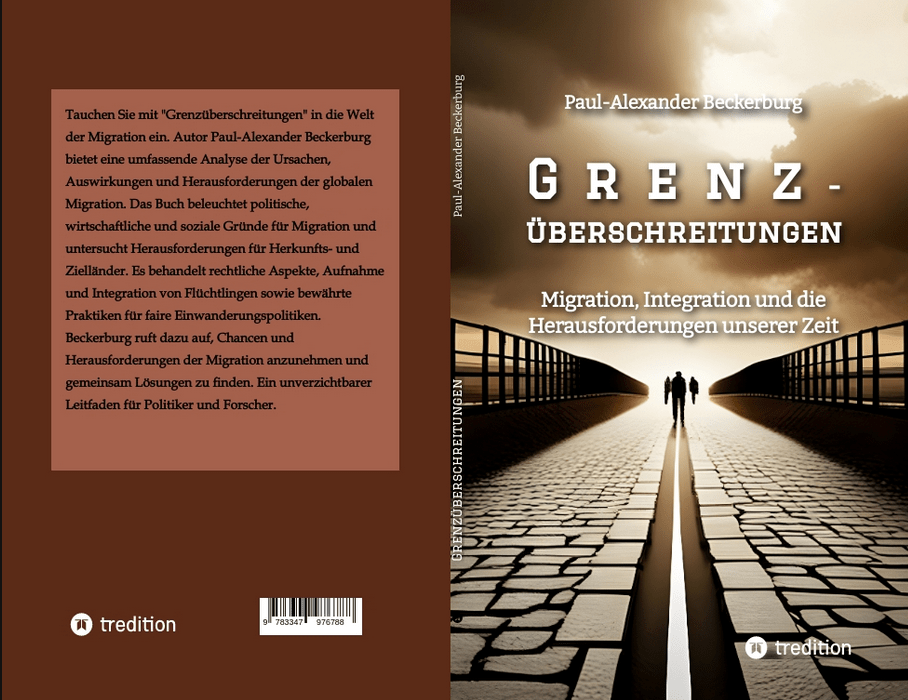Monika Renninger, Pfarrerin und Direktorin des Hospitalhofs, hielt die Laudatio auf Andreas Keller. Für Eberhard Zacher sprach der Münsinger Bürgermeister Mike Münzing. Bereits zum 40. Mal wird in diesem Jahr die Otto-Hirsch-Auszeichnung von der Landeshauptstadt Stuttgart, der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg (IRGW) und der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (GCJZ) Stuttgart verliehen.
Bürgermeisterin Isabel Fezer und Professorin Barbara Traub, Vorsitzende des Vorstands der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg (IRGW), erinnerten anlässlich der 40. Otto-Hirsch-Preisverleihung an die anhaltende Bedeutung dieser Auszeichnung. Bürgermeisterin Fezer sprach dabei nicht nur als Vertreterin der Landeshauptstadt Stuttgart, sondern auch in ihrer Funktion als evangelische Vorsitzende und Sprecherin der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit (GCJZ) Stuttgart. Sie würdigten Andreas Keller und Eberhard Zacher als herausragende Persönlichkeiten, die sich für eine Erinnerungskultur einsetzten, die heute notwendiger denn je ist. Beide Preisträger handeln dabei ganz im Geiste von Otto Hirsch. Mit ihrem Engagement sind sie Vorbilder für eine gelebte und für alle Menschen erfahrbare Erinnerungskultur an die Shoah, die vielfältige Kultur jüdischen Lebens seit 1.700 Jahren im Gebiet des heutigen Deutschlands.
Der Stuttgarter Andreas Keller erhält die Otto-Hirsch-Auszeichnung für sein vorbildliches Engagement in der Stuttgarter Stadtgesellschaft im Sinne Otto Hirschs. Er setzt sich in lebendigen Netzwerken für das Erinnern an die Deportationen jüdischer Menschen aus Stuttgart und Württemberg ein – weit über seine Rolle als Erster Vorsitzender von „Zeichen der Erinnerung“ hinaus.
Eberhard Zacher aus Buttenhausen, Gemeinde Münsingen, hat entscheidend dazu beigetragen, dass 2013 das Jüdische Museum in seiner Heimatgemeinde eröffnet wurde. Er hat wesentlich bei der wissenschaftlichen Begleitung sowie auch an der Konzeption der Ausstellung mitgewirkt. Mit seinem Einsatz gegen das Vergessen hat Zacher die 150-jährige gemeinsame Geschichte des jüdisch-christlichen Zusammenlebens in dem kleinen Dorf im Tal der Großen Lauter auf der Schwäbischen Alb sichtbar gemacht – weit über die lokalen Grenzen hinaus. Einzigartig für die Gemeinden Württembergs hat die Zahl jüdischer Menschen in Buttenhausen die jener Menschen mit christlicher Konfession zeitweise überstiegen.